BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 80 Bewertungen| Bewertung vom 26.05.2022 | ||
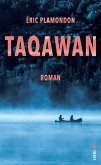
|
Der rote Faden-Verlauf oder Der Widerspenstigen Zähmung. |
|
| Bewertung vom 09.05.2022 | ||

|
Alles hängt mit allem zusammen. |
|
| Bewertung vom 24.03.2022 | ||

|
Quijote und Galileo reichen sich die Hände. |
|
| Bewertung vom 07.03.2022 | ||

|
Es gibt kein richtiges Leben im falschen. (Adorno) |
|
| Bewertung vom 19.02.2022 | ||

|
Hortus conclusus oder Der alte Mann und das Meer |
|
| Bewertung vom 19.02.2022 | ||

|
In der Fremde sprechen die Bäume arabisch Der mit den Bäumen spricht |
|
| Bewertung vom 21.01.2022 | ||

|
Tragische Hoffnungslosigkeit |
|
| Bewertung vom 20.12.2021 | ||

|
Feig, faul und frauenfeindlich Hürdenläufer in der Schönen Neuen Welt 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 08.12.2021 | ||

|
Living in one land, dreaming in another |
|
| Bewertung vom 26.11.2021 | ||
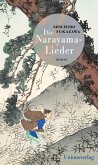
|
Dieses Büchlein ist eine Preziose: der Einband und natürlich der eigentümliche, außergewöhnliche Text selbst mit den Liedern, die mit spöttischem Unterton, das Dorfleben illustrierend, in den Text hineingewebt sind. Eigentümlich, weil er eine ungewöhnliche Schilderung ist, aus einer archaischen Zeit, aus einer archaischen Landschaft. Eine archaische „Triage“. Und doch atmet der Text Lebensfreude, denn Orin hat es akzeptiert, dass sie mit 70 „auf den Berg geht“, nicht dumpf oder aufbegehrend gegen die Tradition, sondern freudig als Lauf des Lebens, als unausweichliches Schicksal. Für uns moderne Menschen ist Orin eine Geisel archaischer Traditionen und die Triage gerade in den aktuellen pandemischen Zeiten ein Stich in das Wespennest unseres modernen Egos. Die verwitwete Orin lebt mit ihrem Sohn Tatsuhei und Enkeln in der „Wurzelhütte“. Das Dorf besteht aus 22 Hütten, alle „getauft“. Das karge Hochland bietet den Dörflern kaum Abwechslung, bis auf das Bon-Fest, bei dem die Ahnen für 3 Tage im Diesseits mit Tanz empfangen werden, Neujahr und das Narayama-Fest. Es gibt nur wenig Anbauflächen. Das bedeutet knappe Ressourcen, und Nahrungsmittel-Diebstahl ist ein großes Tabu im sozialen Gefüge. Beim Narayama-Fest, das nur einmal im Jahr gefeiert wird, wird jedoch üppig getafelt: die Früchte der frühen herbstlichen Ernte und die kostbarste Delikatesse überhaupt, weißer Reis. Orin freut sich auf das Fest, kann sie doch endlich wie alle Alten „auf den Berg gehen“, die wichtigste Reise ihres Lebens antreten, hinauf zum Göttlichen Berg. Sie ist bereit, denn sie hat für ihren Sohn eine neue Frau gefunden, Tamayan. Aber auch ihr Enkel Kesakichi hat sich schon verfrüht eine Frau gesucht, Matsuyan von der „Teichhütte“. Man heiratet spät, jedes neue Familienmitglied ist ein Esser mehr im essenknappen Dorfleben. Der Winter nähert sich. Mehr denn je eine Herausforderung, denn nun gibt es 2 Personen mehr, die essen wollen, zumal Matsuyan wie ein Bär futtert (sie ist im 5. Monat schwanger). Orin fühlt sich überflüssig mit den 2 neuen Frauen im Haus und sehnt sich nach der Reise zum Göttlichen Berg. Endlich gibt ihr Sohn schweren Herzens sein Einverständnis, obwohl die Schwiegertochter meint, man solle das kommende Baby von Matsuyan opfern. Orin lädt zum Abschiedstrunk. 7 Männer und 1 Frau erscheinen, geben Abweisungen und Erklärungen, nehmen Gelübde ab. So ist es Brauch. Es gibt drei Regeln: No. 1: unterwegs nicht sprechen. No. 2: niemand darf sie beim Aufbruch sehen, No. 3: der Begleiter darf bei der Rückkehr vom Berg nicht zurück blicken ( Reminiszenzen an Lots Frau und Orpheus?). Einer gibt Tatsuhei den Tipp: es reiche schon bis zu den 7 Tälern, ein Rat, den er erst auf dem Rückweg versteht. Orin will fort, ermahnt den Sohn, der sie über die 7 Täler, wo es nur einen und doch keinen Weg gebe, (die Symbolik des Unterwegsseins und des finalen Ankommens?) bis auf den Berg, wo der Gott wohnt, trägt. Auf dem Berg legt Orin ihre gewebte Matte zurecht und legt ein Bällchen weißen Reis darauf. Sie schiebt den Sohn in Richtung Abstieg und drückt fest seine Hände. Tatsuhei torkelt weinend abwärts. Er dreht sich nicht um. Doch dann beginnt es zu schneien, und er will dieses Glück mit seiner Mutter teilen, denn sie glaubte fest, dass es schneien würde, wenn sie auf den Berg, wo der Gott wohnt, geht. Er sieht sie beten, die Matte um sich gelegt, vom Schnee umhüllt. Er begegnet bei den 7 Tälern dem Sohn des Nachbarn, der seine Trage abschnallt und den Vater hinabstürzt. Das Schlussbild als „Das Leben geht weiter“-Sinnbild: der Enkel sitzt betrunken in Orins ge-füttertem Wattemantel, seine Frau trägt Orins Stoffgürtel. Und er sagt: Oma hat Glück: es schneit.In diesem kleinen Buch ist alles enthalten, was das menschliche Leben ausmacht: Liebe, Zuneigung, Trauer, Sorge, Neid, Schicksalsergebenheit, Auflehnung, existenzielle Not, Rituale, Würde, Erbarmen. Und der Tod. Der präsent ist als Teil des Lebens. Der in unseren Zeiten verdrängt wird, nur durch Schlagzeil |
|
