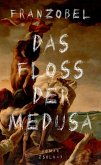BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Benutzername:
Bories vom Berg
Wohnort:
München
Über mich:
Sämtliche von mir geschriebenen Rezensionen sind hier auf Buecher.de veröffentlicht und alle über diese Profilseite abrufbar. Meine eigene Website bietet zusätzlich Auswahlen nach Sterne-Bewertung, listet meine Rezensionen aller wichtigen Buchpreise übersichtlich auf und enthält ergänzend im Anhang viele Informationen rund ums Buch, besuchen Sie mich!
Meine Website: ortaia-forum.de