BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
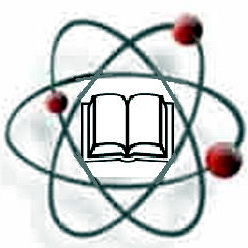
Bewertungen
Insgesamt 3580 Bewertungen| Bewertung vom 15.03.2022 | ||

|
Ludwig Bechstein (1801-1860) war neben den Brüdern Grimm der zweite bedeutende Sammler und Herausgeber deutscher Volksmärchen. Über 150 Märchen gehen auf Bechsteins Bearbeitungen und Sammlungen zurück. Zu seinen bekanntesten Märchenversionen gehören beispielsweise „Der kleine Däumling“ oder „Aschenbrödel“. Seine Märchenbücher sind in zahlreiche Sprachen übersetzt worden. Im Vergleich zu den Grimms Märchen sind Bechsteins Märchen oft kindgerechter (braver) und nicht so grausam. |
|
| Bewertung vom 15.03.2022 | ||
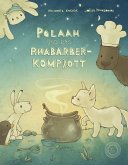
|
POLAAH und das Rhabarber-Kompott „Rhabarber-Komplott .., ist das beste Essen der Welt“, meint Mampf. Davon haben aber seine Freunde Ping, Hops, Gru-Gru und Polaah noch nie etwas gehört. Das muss also etwas ganz Besonderes sein. Sie wissen noch nicht einmal, was Rhabarber ist. Also machen sie sich auf die Suche und sie entdecken tatsächlich die rötlichen Stiele des Rhabarbers. Gemeinsam werden die Stiele geputzt und zerkleinert … und schon dampft der Rhabarber im Kochtopf. Danach sitzen alle fünf Freunde am Strand, beobachten den Sonnenuntergang und mampfen genussvoll ihren Rhabarber-Kompott. |
|
| Bewertung vom 15.03.2022 | ||
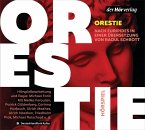
|
„Orestes“ ist ein Spätwerk des griechischen Dramatikers Euripides (um 480 v.u.Z.- 406 v.u.Z.). Iphigenie, die Tochter von Agamemnon und Klytämnestra, wurde in Aulis geopfert, um das nach Troja segelnde Heer der Griechen von einer Flaute zu befreien. Für den Verlust ihrer Tochter nahm Klytämnestra Rache und ermordete ihren Ehemann Agamemnon, als dieser siegreich heimkehrte. Dabei half ihr Aigisthos, den sie nun zum Mann nahm. Für den Gattenmord wiederum musste Klytämnestra büßen, sie wurde von ihrem eigenen Sohn Orestes umgebracht, zusammen mit Aigisthos und angefeuert von seiner Schwester Elektra. Opfertod einer Tochter, Gattenmord, Muttermord - das ist die furchtbare Abfolge des Orestie-Stoffes. Am Ende mündet er in die Ablösung der Blutrache durch das Recht und in die Einsetzung der Polis, des athenischen Stadt- und Rechtsstaates. |
|
| Bewertung vom 15.03.2022 | ||

|
An des Abgrunds schmalem Saume Der deutschsprachige Schriftsteller Hans Leifhelm (1891-1947) ist heute nahezu vergessen, dabei hatte er einen großen Wirkungskreis. Als junger Autor war er zunächst am Niederrhein tätig, später profilierte er sich in Graz, in der Steiermark, wo er Anschluss an die dortigen Künstlerkreise fand. Eine Stelle als Berufsberater und Arbeitsvermittler beim Steirischen Arbeitsnachweis gab der Familie die finanzielle Sicherheit für seine literarischen Aktivitäten. Leifhelms Versuche, danach noch einmal in Deutschland beruflich Fuß zu fassen, scheiterten jedoch. Leifhelm, der vor allem als Lyriker tätig war, korrespondierte u.a. mit Stefan Zweig und Thomas Mann. Die letzten Lebensjahre ver-brachte er mit massiven Gesundheitseinschränkungen in Italien, wo er am 1. März 1947 in Riva verstarb. |
|
| Bewertung vom 14.03.2022 | ||
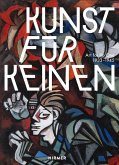
|
In der Vergangenheit lag der Schwerpunkt der Auseinandersetzung der deutschen Kunst in den 1930er und 1940er Jahren zumeist in der Gegenüberstellung von NS-Kunst und „entarteter Kunst“ oder in der Darstellung der Exil-Kunst. Die Ausstellung „Kunst für Keinen 1933-1945“ in der Schirn Kunsthalle Frankfurt (4. März bis 6. Juni 2022) richtet den Blick nun auf die Künstler und Künstlerinnen, die nach 1933 in Deutschland blieben, sich aber abseits des nationalsozialistischen Kunstbetriebs bewegten. Sie fanden bisher kaum Beachtung. Mit der Ausstellung rücken neben ihrem Werk auch ihre Lebens-und Arbeitssituationen in das Interesse der Öffentlichkeit. Dabei werden anhand von vierzehn Biografien die künstlerischen Handlungsspielräume während des Nationalsozialismus beleuchtet. |
|
| Bewertung vom 11.03.2022 | ||

|
Die Französin Babette, daheim eine Spitzenköchin, hat es in das norwegische Dörfchen Berlevaag verschlagen, wo sie seit Jahren ihren Dienst im Haushalt der beiden Pfarrerstöchter Philippa und Martine erledigt. Ihre Herrinnen wissen nicht, über welche Talente Babette eigentlich verfügt. Im hohen pietistischen Norden hat kaum jemand Interesse an Gourmetgenüssen. Hier muss Babette meist Stockfisch und Brotsuppe zubereiten. Doch eines Tages ergibt sich die Gelegenheit, dass Babette ihre Kochkünste zeigen kann. Sie hat in der Lotterie gewonnen und lädt die beiden Damen und eine Handvoll Gäste zu einem echten französischen Festmahl ein. Mit ihrer lukullischen Verführungskunst begeistert sie die Gäste mit einem meisterhaften und romantischen Dinner. |
|
| Bewertung vom 10.03.2022 | ||

|
Der Spaziergang erlebt während der Pandemie seine große Renaissance. Aber bereits seit der Antike hilft er den Menschen beim Entspannen und Denken, beim Zusichkommen und die Umwelt mit anderen Augen zu sehen. „Das Gehen bringt einen am dichtesten an die Welt heran“ lautet ein Sprichwort. Gemeint ist das Flanieren nicht im Jogging-Tempo. |
|
| Bewertung vom 28.02.2022 | ||
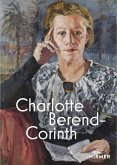
|
Charlotte Berend-Corinth (1880-1967) war nicht nur Ehefrau und Muse des bekannten Malers Lovis Corinth (1858-1925). Obwohl sie jahrelang auf diese Rolle beschränkt war, war sie doch auch eine eigenständige Künstlerin und gehörte zu den wenigen weiblichen Mitgliedern der Berliner Secession. Sie setzte schon früh eigene künstlerische Akzente und spielte nach dem Tode ihres Mannes eine zentrale Rolle in der Kunstszene von Berlin. |
|
| Bewertung vom 24.02.2022 | ||

|
Simone Lappert ist eine Schweizer Schriftstellerin, die ihr literarisches Debüt mit dem Roman „Wurfschatten“ vorlegte. Nun ist mit „längst fällige verwilderung“ ihr erster Lyrikband erschienen. Der schmale Band versammelt Gedichte, die viele Bereiche unseres Lebens berühren. Man könnte sagen, es sind liebevolle Bestandsaufnahmen des Lebens. Dabei sind die Sujets und Themen vielfältig, die Lappert bewegend und emotional gekonnt verarbeitet. |
|
| Bewertung vom 22.02.2022 | ||
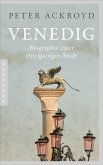
|
Eine Biografie der Lagunenstadt. Der bekannte britische Schriftsteller Peter Ackroyd geht dabei nicht streng chronologisch vor. Er beginnt natürlich mit den Ursprüngen, als bereits im 8. vorchristlichen Jahrhundert Vertriebene vom Festland sich der Inselchen in der Lagune bemächtigten. Der Aufbau der Stadt selbst begann im 6. Jahrhundert und irgendwann war die Stadt dann fertig, Für Ackroyd etwa Mitte des 16. Jahrhunderts. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
