BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 894 Bewertungen| Bewertung vom 20.07.2017 | ||
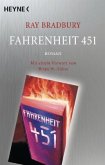
|
Albtraum für Bibliophile |
|
| Bewertung vom 19.07.2017 | ||
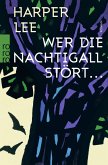
|
Neues von der Spottdrossel |
|
| Bewertung vom 16.07.2017 | ||

|
Big Apple als Protagonist 3 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 04.07.2017 | ||
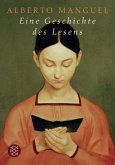
|
Vom Manna des Lesens |
|
| Bewertung vom 30.06.2017 | ||

|
Geistreiche Polemik |
|
| Bewertung vom 11.06.2017 | ||

|
Das Buch der Slapsticks |
|
| Bewertung vom 07.06.2017 | ||
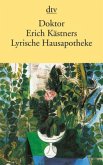
|
Doktor Erich Kästners lyrische Hausapotheke Risiken und Nebenwirkungen unbekannt |
|
| Bewertung vom 02.06.2017 | ||
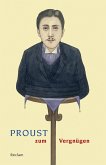
|
Amüsantes vom Jahrhundert-Romancier |
|
| Bewertung vom 25.05.2017 | ||

|
Vom philosophischen Olymp 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 25.05.2017 | ||
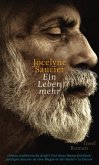
|
Wenn es Vögel regnet |
|
