BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 196 Bewertungen| Bewertung vom 16.02.2024 | ||

|
Sommer 1987, irgendwo im Sauerland: Als der 19-jährige Jirka nach fünfjährigem Aufenthalt in einem Internat erstmals wieder den väterlichen Hof besucht, fühlt er sich nicht gerade willkommen. Sein Vater Georg glänzt durch Abwesenheit, Schwester Malene begrüßt ihn nicht einmal, Großmutter Agnes ist mittlerweile dement und erkennt ihn schwerlich. Und auch Leander, der Sohn des ehemaligen Gutsverwalters, wirkt nicht sonderlich begeistert über Jirkas Rückkehr. Der Hof im Krummen Holz hat seine besten Zeiten hinter sich und steht kurz vor dem Verkauf. Doch je länger sich Jirka dort aufhält, desto intensiver werden die Gedanken an seine Kindheit. |
|
| Bewertung vom 14.02.2024 | ||

|
Nach einem Autounfall sitzen Karo und Risto leicht verletzt in einem eingeschneiten Hotel in Lappland fest, dem exorbitant teuren "Arctic Mirage". 700 Euro pro Nacht muss das kriselnde Pärchen, für das Geld jedoch keine Rolle spielt, dafür berappen. Während Karo sich in der ungewohnten Umgebung zunehmend unwohl fühlt, scheint Risto den Aufenthalt gern auf unbestimmte Zeit verlängern zu wollen. Als Karos persönliche Gegenstände nach und nach verschwinden, spitzt sich die Situation zu. Ist das alles wirklich auf ihre leichte Gehirnerschütterung zurückzuführen? Und wieso bestreitet Risto eigentlich vehement, dass in den Unfall ein blauer Lieferwagen involviert war, an den Karo sich nur zu gut erinnert? Während der Schnee alles verdecken will, macht sich Karo daran, ihren Zweifeln auf den Grund zu gehen... |
|
| Bewertung vom 23.01.2024 | ||

|
Maramuresch, im Norden Rumäniens: Lev und Kato sind seit Kindheitstagen eng miteinander befreundet. Doch nach dem Ende des Ceauşescu-Regimes trennen sich ihre Wege. Während Kato gemeinsam mit ihrem Freund Tom als Straßenkünstlerin durch Europa zieht, sieht sich Lev noch nicht bereit, die Heimat zu verlassen. Als ihn eines Tages eine Nachricht von Kato erreicht, gerät er ins Grübeln. Der Inhalt: die drei folgenschweren Worte "Wann kommst du?" |
|
| Bewertung vom 12.01.2024 | ||

|
DUMONT Bildband Orte zum Staunen in Deutschland Nimmt man das neue Buch „Orte zum Staunen in Deutschland“ erstmals in die Hand, gerät man selbst ins Staunen. Zunächst einmal über das Gewicht. Denn der Bildband mit seinen großformatigen Seiten wiegt ganz schön schwer. Nichts also, was man sich mal eben in den Rucksack steckt und einfach drauflos wandert. Zum anderen staunt man über das Cover: eine exotische Pyramide, etwas aus Thailand und die Rocky Mountains - denkt man auf den ersten Blick. Das sollen Orte in Deutschland sein? 336 Seiten später ist man schlauer. Ja, die Fotos stammen tatsächlich aus Deutschland. Sie sind Teil der „52 überraschenden Entdeckungstouren“, die MairDumont im Untertitel verspricht. |
|
| Bewertung vom 05.01.2024 | ||

|
"Die leuchtende Republik" des in Argentinien lebenden Spaniers Andrés Barba, in der deutschen Übersetzung von Susanne Lange bei Luchterhand erschienen, ist ein zutiefst seltsamer und ungewöhnlicher Roman. |
|
| Bewertung vom 07.11.2023 | ||

|
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts flieht Unni gemeinsam mit ihrem Mann Armod und Söhnchen Roar zu Fuß von Norwegen nach Schweden. Die Frau, eine junge Heilerin, soll offenbar wegen eines tödlichen Behandlungsfehlers eingesperrt werden, doch ihr gelingt die Flucht. In den Wäldern Schwedens findet sie mit ihrer Familie ein neues Zuhause, genannt "Frieden". Ein zynischer Name, denn tatsächlich stellt sich der gewünschte Frieden nie ein. Mehr als 70 Jahre später existiert das Haus noch immer, mittlerweile leben dort Kåra und ihre Schwiegermutter Bricken. Gemeinsam sind sie dabei, Roars Beerdigung zu planen. |
|
| Bewertung vom 19.10.2023 | ||
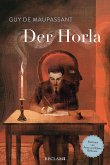
|
"Wie schön es heute war!" Kann man einem Buch, noch dazu einer klassischen Schauergeschichte wirklich trauen, wenn sie so beginnt? Natürlich nicht! Und so überrascht es nicht, dass auch "Der Horla" von Guy de Maupassant (1850 - 1893) sich nicht auf die Schönheit dieses ersten Satzes verlässt, sondern die Leserschaft Stück für Stück und anfangs beinahe unmerklich in den Wahnsinn seines namenlosen Ich-Erzählers hineinzieht und sie bis zum drastischen Finale auch nicht mehr loslassen wird. Unverkennbar schön sind allerdings die Illustrationen der italienischen Zwillingsschwestern Anna und Elena Balbusso, die diese Ausgabe zu einem bibliophilen Augenschmaus machen. Oder kurz gesagt zum Wahnsinn im Prachtkleid. |
|
| Bewertung vom 18.10.2023 | ||

|
Leni Müller lebt mit ihrem Mann Ivan in Berlin-Steglitz. Es ist ein einsames Leben. Während der erfolgreiche Architekt einmal mehr einen lukrativen Auftrag für sich entscheidet, kapselt sich Leni ab. Ihre täglichen Einkäufe sind schon das Höchste der Gefühle. Als Ivan für ein Bauprojekt nach Rügen reisen muss, ist Leni plötzlich auf sich allein gestellt. Überfordert von der Welt scheint sie plötzlich Dinge zu sehen und zu hören, die gar nicht real sind. Und was will eigentlich dieser Kommissar Ziegler von ihr, der ihr auf Schritt und Tritt zu folgen scheint? Nach und nach drängen vergangene Dinge in Lenis Bewusstsein, die sie behutsam in Richtung Abgrund ziehen wollen... |
|
| Bewertung vom 17.10.2023 | ||

|
Als der schwedischen Historikerin Linda Segtnan während ihrer Arbeit im Archiv zufällig ein Zeitungsausschnitt über den Mord an der neunjährigen Birgitta Sivander im Jahre 1948 im schwedischen Perstorp in die Hände fällt, ist ihr Interesse sofort geweckt. Wer war diese Birgitta und wieso konnte der Fall nie geklärt werden? Die hochschwangere Frau beginnt zu recherchieren, sichtet Materialien, besucht den Tatort und spricht mit damaligen Zeug:innen. Doch die Recherchen bringen Segtnan nicht nur an ihre körperlichen Grenzen. Ganz langsam scheinen sich auch in ihrem Bewusstsein die unterschiedlichen Zeitebenen aufzuheben, so dass die Autorin das Gefühl bekommt, unmittelbarer Teil der Ermittlungen Ende der 1940er-Jahre zu sein und eine besondere Verbindung zu Birgitta herzustellen. Über allem scheint die Angst vor dem Tod, der Vergänglichkeit zu schweben. Und so steigert sich Linda in eine Art Besessenheit hinein, um den Mordfall neu aufzurollen und endlich aufzuklären. Eine Besessenheit, die auch die Existenz ihrer eigenen Familie infrage stellt... |
|
| Bewertung vom 09.10.2023 | ||

|
Die Legende vom heiligen Trinker Paris, 1934: Andreas ist ein obdachloser Alkoholiker und lebt irgendwo unter den Brücken an der Seine. Als ein gut gekleideter Herr ihm begegnet, scheint sich das Glück auf seine Seite zu schlagen. Schließlich schenkt ihm der Mann 200 Francs und fordert sie nicht einmal zurück. Doch Andreas sieht sich als Ehrenmann und besteht auf die Rückzahlung. Der Herr lässt sich darauf ein, fordert Andreas aber auf, nicht ihm das Geld zurückzugeben, sondern es der Heiligen Thérèse von Lisieux in einer Pariser Kirche zu widmen. Kein Problem für den Ehrenmann Andreas - wäre da nicht der permanente Alkoholdurst... Doch auch wenn die 200 Francs schnell ausgegeben sind, scheint Andreas das Glück plötzlich gepachtet zu haben. Ein Wunder der kleinen Thérèse? Doch wie lange kann man sich auf Wunder verlassen? |
|
