BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 894 Bewertungen| Bewertung vom 21.03.2017 | ||
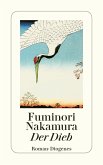
|
Ästhetik des Taschendiebstahls |
|
| Bewertung vom 16.03.2017 | ||

|
Wahrheit als Menetekel 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 09.03.2017 | ||
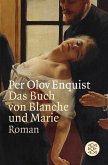
|
Das Buch von Blanche und Marie Omnia vincit amor |
|
| Bewertung vom 05.03.2017 | ||
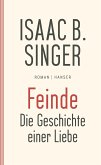
|
Feinde, die Geschichte einer Liebe Tragisch-komisches Gefühlschaos |
|
| Bewertung vom 28.02.2017 | ||

|
Fragwürdiger Kultroman |
|
| Bewertung vom 26.02.2017 | ||
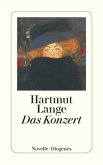
|
Unerhörtes aus dem Totenreich 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 23.02.2017 | ||
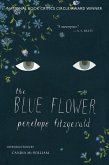
|
Britischer Hype um deutschen Romantiker 0 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 20.02.2017 | ||
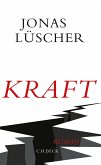
|
Skeptische Gelehrtensatire 0 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 15.02.2017 | ||
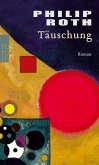
|
Postkoitales Verwirrspiel |
|
| Bewertung vom 13.02.2017 | ||

|
Reine Beziehungskiste 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
