BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 177 Bewertungen| Bewertung vom 15.06.2023 | ||
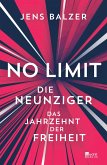
|
Es hat etwas von Größenwahn, die Vielschichtigkeit, Gleichzeitigkeit und Energie eines Jahrzehnts mit Anspruch auf Vollständigkeit in 380 Seiten zusammenzuführen, doch Balzer gelingt es effortless zum dritten Mal. Nachdem er schon die Siebziger und die Achtziger ausgehend vom Popkulturellen nahebrachte, reinszeniert er nun die Atmosphäre der Neunziger. Er verblendet die wichtigsten politischen Ereignisse, technische Neuerungen, sich verändernde Bedürfnisse, Codes, Praktiken und popkulturelle Phänomene des Jahrzehnts. Insbesondere die Popkultur beschreibt Balzer hinreißend in einem an die Neunziger anklingenden Habitus, der die Begeisterungen und Überzeugungen des Jahrzehnts mit Abstand in leiser Ironie betrachtet und es vermeidet, sich zu identifizieren. Die technischen Neuerungen, etwa Privatfernsehen, MTV, Internet und immer mobilere Telefonie, arbeitet er findig heraus. Den politischen Diskursen und Ereignissen stehen die Komprimierung und Haltung hingegen nicht immer gut. Sie bekommen zu viel Raum für eine zeitgeschichtliche Rahmung und zu wenig für eine gelungene Einordnung. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau, denn »No Limit« gelingt es zu gut, die Stimmungen und Widersprüche der Neunziger aufleben zu lassen und die Fäden ihrer Einflüsse bis heute zu spannen. |
|
| Bewertung vom 13.06.2023 | ||
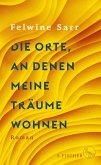
|
Die Orte, an denen meine Träume wohnen »Nach der Tradition der Heimat war Fodé zwar mein Zwillings-, aber auch mein großer Bruder. Er hatte mich zuerst zur Welt kommen lassen und war dann selbst hinaus gegangen. Er hatte mir den Vortritt gelassen.« | 93 |
|
| Bewertung vom 13.06.2023 | ||
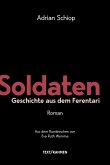
|
Adrian zieht es ins Ferentari, in jenes Viertel von Bukarest, in dem der Zugang zu Strom und Wasser nicht selbstverständlich ist, dafür der Verfall, Kriminalität, Drogen und Prostitution. Wer arm ist, versucht weg zu kommen. Doch das gelingt vielen, darunter oft Roma ohne Papiere, leider nicht. Mit vielen anderen Akademiker:innen und Expats hält sich der Doktorand und Arztsohn am Rande des Viertels auf, mit einem "forschenden Blick". Adrian faszinieren die Kneipen, die Direktheit und besonders die Männer, die er bezahlt, ihn zu befriedigen, wenn er betrunken ist. Zu seinem Schwulsein kann er noch nicht stehen. Als ihn seine Freundin verlässt, verschwimmen Grenzen - so scheint es - und er beginnt eine Beziehung mit Alberto, einem trinkfesten, knasterfahrenen, spielsüchtigen Mann, anscheinend Mitglied einer berüchtigten Roma-Familie. |
|
| Bewertung vom 13.06.2023 | ||
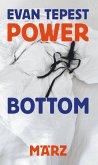
|
Wow, a 10... I mean the book is... |
|
| Bewertung vom 24.05.2023 | ||

|
Das Baby ist nicht das verdammte Problem »Ich bin glücklich, dieses Baby in meinem Leben zu haben. Es ist großartig. Seitdem ich Mutter bin, könnte ich aber zu jeder Tages- und Nachtzeit mindestens zehn Dinge nennen, die mich an meiner Mutterschaft so wütend machen, dass ich schreien möchte.« |96 |
|
| Bewertung vom 24.05.2023 | ||

|
Vogelmenschen betrachten die Welt von oben, gehen auf in Konzepten, Ästhetik und Logik. Fischmenschen hingegen suchen das Kollektiv, während Bärenmenschen sich für Einzelne entscheiden, ihre Liebsten hegen und pflegen. Mira ist ein Vogelmensch, sie denkt die Welt in Konzepten, liebt Bücher und die Kunst. Menschen fallen ihr schwer. Ihr Papa, ein Bärenmensch, ist ihr zu eng und nahe. In Annie, einen Fischmenschen, verguckt sie sich, doch die flutscht weg. Als ihr Papa stirbt, gerät sie in schwer greifbare Zustände, die wir von außen als Trauer bezeichnen könnten. Sein Geist schlüpft in sie und gemeinsam werden sie zu einem Blatt, bis Annie Mira wieder herauszieht, doch Annie erwidert Miras Avancen nicht. |
|
| Bewertung vom 12.05.2023 | ||

|
Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre »Das Fräulein« von Ivo Andrić genau vergriffen war. Meine stets gehütete 1958 bei Aufbau erschienene Taschenbuchausgabe für 1,85 DM fällt schon fast auseinander, weil ich sie immer mal wieder las. Entsprechend groß war meine Freude, dass Zsolnay nun die Übersetzung von Edmund Schneeweis noch einmal von Katharina Wolf-Grießhaber überarbeiten ließ und »Das Fräulein« mit einem Nachwort von dem Andrić-Biographen Michael Martens versah. Einzig das Nachwort enttäuschte mich etwas, da es eher anekdotenhaft auf Andrić eingeht und wenig auf die Ambivalenz des Literaten und machtnahen Diplomaten, dem neben großer Anerkennung für sein Werk auch Schweigen und Opportunismus vorgeworfen wird. |
|
| Bewertung vom 12.05.2023 | ||
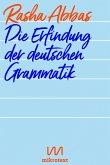
|
Die Erfindung der deutschen Grammatik Short Story Queen Rasha Abbas schreibt in »Die Erfindung der deutschen Grammatik« über Berlin, beabsichtigte und unbeabsichtigte Missverständnisse beim Ankommen, die kleinen Fiesitäten und den sportlichen Weltbewerb untereinander, die Vermeidung des Wortes Jobcenter in der U-Bahn, über Superman, Sherlock, über anzügliche und ganz klar weibliche Zitronen, über den Vorschlag von kulturellen Kochaustauschen (immer noch?), über Kunstscheiß, Literaturscheiß und auch immer wieder über das sich reiben an der deutschen Grammatik. |
|
| Bewertung vom 12.05.2023 | ||
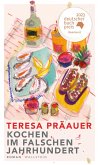
|
Kochen im falschen Jahrhundert Ottolenghi, Manufaktum, Ittala, einladender dänischer Esstisch, Open House, effortless, Wiesenblumen, Quiche Lorraine, Cremant, IPhone, Instagrampost. Neue Wohnung, Bananenkisten, unausgepackt. Innenstadt, wohl Wien. Zwei Paare, Weiß, österreichisch, eins mit Kind, eins ohne, ein Schweizer, Dozent, der immer etwas zu dozieren hat, seine Freundin kommt nicht mit. Schwarze Musik, kultiviert, leise, wie Easy Listening im Hintergrund, dabei hätte sie etwas zu sagen. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 12.05.2023 | ||

|
»Das Phantom« ist eine Hommage an Thomas Bernhard, oder ist es eine Parodie? Diese anachronistisch-monologisierende Prosa eines Nahtodes hat von beidem etwas. Doch so oder so, was ist eine Parodie auf eine zur Zeitgeschichte gewordene Person des öffentlichen Lebens anderes als eine Hommage? |
|
