BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 110 Bewertungen| Bewertung vom 29.06.2022 | ||
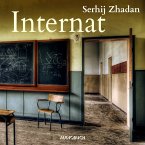
|
Pascha will seinen Neffen aus dessen Internat nach Hause holen. Zu unsicher ist die Situation geworden, der Junge soll Zuhause bei seiner Familie sein. Weit hat Pascha es nicht, das Internat liegt in der nächsten größeren Stadt, unweit seines Dorfes. Aber als er losfährt, merkt er schnell, dass sich das Kampfgeschehen verlagert hat, die Situation viel brenzliger ist, als er ahnte. Mitten durch die Front geht seine Reise und der Rückweg mit dem Jungen wird zu einer Odyssee, die mehrere Tage dauern und beide in Gefahr bringen wird. 1 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 26.06.2022 | ||
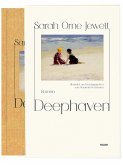
|
In der Regel beginne ich meine Buchbesprechungen mit einer kurzen Inhaltsangabe. Bei „Deephaven“ von Sarah Orne Jewett ist das mit einem Satz getan: Die Freundinnen Kate und Helen beschließen, den Sommer im Haus von Kates verstorbener Tante in Deephaven zu verbringen. Den Rest des Buches verbringen wir damit, den beiden jungen Frauen durch das Dorf an der Küste von Maine zu folgen und die Bewohner näher kennenzulernen. |
|
| Bewertung vom 19.06.2022 | ||

|
Yasmin Ghorami ist an einem Punkt in ihrem Leben, wo alles perfekt zu laufen scheint. Als Assistenzärztin in der geriatrischen Abteilung hat sie einen sinnvollen Beruf mit guten Zukunftsaussichten, in ihrem Verlobten Joe, ebenfalls Arzt, eine liebevolle Beziehung. Das Verhältnis zu ihren aus Indien stammenden muslimischen Eltern ist stabil und auch mit Joes Mutter Harriet, einer entschiedenen Feministin, die sich für sexuelle Befreiung starkmacht, versteht sie sich gut. Yasmins größte Sorge scheint die erste Zusammenführung dieser beiden ungleichen Familien zu sein, möglichst ohne Katastrophen und Szenen. Doch überraschender Weise läuft das Treffen gut, besonders die beiden Mütter entwickeln schnell eine enge Freundschaft. Die wahren Fallstricke lauern woanders. Mit dem Näherrücken der Hochzeit entdecken sowohl Yasmin als auch Joe Aspekte ihrer Familien, die sie zwingen, ihre eigenen Wünsche, Vorstellungen und Beziehungen völlig neu zu überdenken. |
|
| Bewertung vom 15.06.2022 | ||

|
Entscheidung in Kiew (MP3-Download) Seit über hundert Tagen oder seit über hundert Tagen plus acht Jahren herrscht Krieg in der Ukraine und jeden Tag werden wir mit Neuigkeiten aus einem Land konfrontiert, über das die meisten von uns bisher nicht viel gewusst haben, obwohl es flächenmäßig das zweitgrößte Land Europas ist. Dass das Interesse an diesem Staat steigt, kann man gut an dem vermehrten Angebot an Literatur, Podcasts und Dokumentationen zum Thema beobachten, und so stieß ich, nachdem ich einige Romane, die in der Ukraine spielten, gelesen hatte, auf das Sachbuch „Entscheidung in Kiew – Ukrainische Lektionen“ von Karl Schlögel. |
|
| Bewertung vom 10.06.2022 | ||

|
Olenka hat den Weg gewählt, den nicht wenige junge und mittellose Frauen besonders in osteuropäischen Ländern nehmen: Sie hat sich als Eizellspenderin für reiche kinderlose Familien zur Verfügung gestellt. Doch Olenka hat Glück, schnell steigt sie in ihrer Firma auf, wird selbst zu einer jener Frauen, die für verzweifelte Paare mit Ansprüchen junge Spenderinnen oder Leihmütter auswählen. |
|
| Bewertung vom 07.06.2022 | ||

|
Die junge Yingzhi träumt von Freiheit und Reichtum. Um ihr Ziel zu erreichen, beginnt sie, in einer Karaoke-Band auf Hochzeiten und anderen Feiern zu singen, und scheut sich auch nicht, ihre körperlichen Vorzüge einzusetzen. Doch als sie schließlich durch eine unwesentliche Affaire schwanger wird, sieht Yingzhi sich gezwungen, den Vater ihres Kindes zu heiraten und ihre großen Träume auf andere Weise zu verwirklichen. Was sich als schwer erweist, denn ihr Mann entpuppt sich als arbeitsscheuer Trinker, der alles Geld zum Spieltisch trägt. Die Beziehung der beiden wird immer aggressiver und gewaltgeladener, bis Yingzhi den einen Schritt macht, der die Lage außer Kontrolle geraten lässt... |
|
| Bewertung vom 02.06.2022 | ||

|
Sergej Sergejitsch lebt in Malaja Starogradowka in der Grauen Zone, dem Puffergebiet zwischen der Ukraine und dem Dombass. Das Dorf ist mittlerweile verlassen, die Bewohner tot oder geflüchtet. Die Kriegsfront ist in Hörweite, ab und zu verirrt sich ein Geschoss in das Wohngebiet. Außer Sergejitsch ist nur noch Pascha geblieben, der alte Feind aus Schulzeiten, mit dem es sich jetzt, in der neuen Situation, aber leidlich auskommen lässt. Pascha und Sergejitschs Bienen, die in ihren Stöcken Winterruhe halten. |
|
| Bewertung vom 28.05.2022 | ||

|
Nach der Scheidung ihrer Eltern leben Agda, Nick und Jula Emmerich bei der Mutter, aber diesen Sommer dürfen sie drei Wochen allein mit ihrem Vater Claus in Bayern verbringen. Das abgelegenste Haus auf dem Krähenriegel hat Claus ausgesucht, um seinen Kindern die Natur näher bringen zu können und die Ruhe zu genießen. Aber von Ruhe kann keine Rede sein. Gleich zu Beginn bricht sich Claus den Fuß, Jula findet eine verzauberte Katzenmumie, Nick wird von Felix, einem Jungen aus dem Dorf, auf mehrere Mutproben geschickt, um zu beweisen, dass er dazu geeignet ist, mit Felix auf eine Schatzsuche zu gehen, während Agda überlegt, ob eben jener Felix wirklich so ein öder Bauerntrottel ist, wie sie erst dachte. Und dann stellt sich auch noch die Frage, ob die Emmerichs wirklich allein auf dem Krähenriegel sind… |
|
| Bewertung vom 22.05.2022 | ||

|
Als Fred ihre Stelle als Konsulin in Montevideo antritt, scheinen ihre Aufgaben überschaubar. Die Planung eines Festes zum Tag der Deutschen Einheit ist vorerst die größte Herausforderung, die sie erwartet. Doch dann verschwindet eine junge Deutsche. Und nicht nur irgendeine, sondern die Tochter einer einflussreichen Medienvertreterin. Konsequenzen müssen folgen, und so wird Fred von ihrem Posten abgezogen und, nach einer kurzen Zwischenstation in Bonn, in das Konsulat in Istanbul versetzt. Hier ist die politische Lage eine ganz andere, als in Uruguay. Regierungskritikern wird die Ausreise verboten, sie landen in Gefängnissen oder verschwinden spurlos. Auch solche mit deutscher Staatsangehörigkeit. Und so gerät Fred schnell an die Grenzen ihrer legalen Befugnisse und muss eine Wahl zwischen ihrem diplomatischen Auftrag und den eigenen Werten treffen. |
|
| Bewertung vom 21.05.2022 | ||

|
Badlapur, Uttar Pradesh, Indien. Smita gehört zu den Dalit, den Unberührbaren. Jeden Tag muss sie in ihrem Dorf die Aborte der Einwohner leeren, einen Beruf, den sie von ihrer Mutter übernommen hat. So ist es vorgesehen, die Geburt bestimmt das Schicksal unwiderruflich. Trotzdem wünscht sich Smita für ihre Tochter Lalita etwas anderes. Sie soll zur Schule gehen, lernen, einen anderen Beruf ergreifen können. Doch Smitas Versuch, Lalita in der örtlichen Schule unterzubringen, scheitert. Und ihr wird klar, dass nur die Flucht aus der Heimat etwas an Lalitas Schicksal ändern könnte. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
