BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 833 Bewertungen| Bewertung vom 25.02.2013 | ||

|
Sie dürfen Watson zu mir sagen 14 von 15 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 25.02.2013 | ||
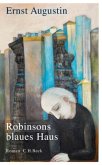
|
… und alle Fragen offen 2 von 3 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 25.02.2013 | ||
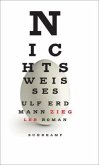
|
Dingbat 2 von 6 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 25.02.2013 | ||

|
Ein müder Abklatsch 3 von 7 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 25.02.2013 | ||

|
Wenn die Kinder aus dem Haus sind 1 von 5 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 25.02.2013 | ||

|
Die uninteressante Natur war uninteressant 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 25.02.2013 | ||

|
Für Leser mit Sinn für das Absurde 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 25.02.2013 | ||

|
Lektüre mit Bonus |
|
| Bewertung vom 25.02.2013 | ||

|
Extrem laut und unglaublich nah Keine brav herunter geschriebene Prosa 1 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 25.02.2013 | ||

|
Ein Verriss und seine Folgen 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|