BenutzerTop-Rezensenten Übersicht
Bewertungen
Insgesamt 368 Bewertungen| Bewertung vom 23.04.2022 | ||

|
Red Traitor / Alexander Wassin Bd.2 REZENSION – Noch nie war seit den Jahren der militärischen Abrüstung und des Friedens in Europa die Angst vor einem russischen Atomschlag so groß wie gerade jetzt im Ukraine-Krieg. Dadurch bekommt der bereits im Juli 2021 in Großbritannien und schon im Januar beim Lübbe Verlag veröffentlichte Spionage-Thriller „Red Traitor“ des britischen Schriftstellers Owen Matthews (51) eine unerwartete Aktualität. Denn auch dieser zweite Band der spannenden Politthrillerreihe um Alexander Wassin, Top-Agentenjäger des sowjetischen Geheimdienstes KGB zu Beginn der 1960er Jahre, handelt von der Angst vor einem Atomschlag der Sowjets und einem dritten Weltkrieg. |
|
| Bewertung vom 08.04.2022 | ||

|
REZENSION – Mit seinem Roman „Kronsnest“ gelang Florian Knöppler (56) im vergangenen Jahr ein eindrucksvolles und viel beachtetes Debüt über das dörfliche Leben in der holsteinischen Elbmarsch in den 1920er Jahren zur Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus. Mit einem Zeitsprung ins Jahr 1941 setzt er nun in „Habichtland“, im Februar beim Pendragon Verlag erschienen, seine Erzählung um den inzwischen erwachsenen Kleinbauern Hannes, Ehefrau Lisa, seine Freundin Mara von Heesen und Stiefvater Walter fort. Obwohl die Protagonisten dieselben sind, hat sich nach 15 Jahren nicht zuletzt durch Umwälzung der politischen Gegebenheiten ihr Leben verändert, weshalb „Habichtland“ nicht zwingend als Fortsetzung, sondern durchaus als eigenständiger Roman mit anderem Themenschwerpunkt gelesen werden kann. |
|
| Bewertung vom 01.04.2022 | ||

|
Der Hauptmann und der Mörder / Die 18/4-Serie Bd.1 REZENSION – Zwölf Jahre hat es gedauert, bis die bereits 2009 bis 2011 im Original veröffentlichte und 2014 in der Volksrepublik China verfilmte Thriller-Trilogie des chinesischen Schriftstellers Zhou Haohui (44) um die Polizeieinheit 18/4 und Polizeihauptmann Pei Tao dank des Heyne-Verlags es endlich im Januar auf den deutschen Buchmarkt geschafft hat. Doch das Warten hat sich gelohnt: Gleich der erste Band ist ein Thriller der Spitzenklasse, der im literarischen Ansatz wohl nicht allein für den asiatischen, sondern gleich für den internationalen Markt bestimmt gewesen zu sein scheint. Denn obwohl die Handlung in der chinesischen Millionenstadt (Provinz Sichuan) angesiedelt ist, fehlt ein typischer Bezug zu China oder asiatischen Charakteristika. Stattdessen könnte der Thriller auch in jedem westlichen Land spielen. Lediglich der philosophische Ansatz des Yin und Yang mag typisch für China sein, die beiden einander entgegengesetzten und dennoch direkt aufeinander bezogenen, von einander abhängigen Kräfte des negativen Yin und des positiven Yang. Doch wird dies erst später im Thriller erkennbar. |
|
| Bewertung vom 22.03.2022 | ||

|
SØG. Schwarzer Himmel / Nina Portland Bd.2 REZENSION – Erst mit seiner vielfach übersetzten Thrillerreihe um den Kriegsveteranen Niels Oxen und seine Partnerin, die einbeinige Agentin des dänischen Sicherheitsdienstes Margrethe Franck, wurde der dänische Kriminalschriftsteller Jens Henrik Jensen (58) international und ab 2018 auch in Deutschland bekannt. Grund genug also für die dtv Verlagsgesellschaft, seine zuvor ab 2004 in Dänemark erschienene Thriller-Trilogie um die junge Agentin Nina Portland noch einmal in überarbeiteter Taschenbuchausgabe herauszubringen. Nach dem ersten Band „SØG. Dunkel liegt die See“ (Mai 2021), der bereits 2006 unter dem Titel „Das Axtschiff“ erschienen war, folgte nun im November „SØG. Schwarzer Himmel“, ursprünglich 2008 als „Der Kohlenmann“ veröffentlicht. Der noch nie übersetzte dritte Band soll dann im Juli unter dem Titel „SØG. Land ohne Licht“ erstmals auf Deutsch folgen. Die bislang fehlende Übersetzung des dritten Bandes mag ein Zeichen sein, dass diese frühere Trilogie des dänischen Autors vor zehn Jahren in Deutschland nicht erfolgreich war. |
|
| Bewertung vom 12.03.2022 | ||
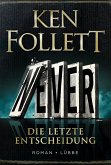
|
Never - Die letzte Entscheidung REZENSION - Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs ist die Lektüre des bereits im November im Lübbe Verlag erschienenen und ein Jahr zuvor verfassten Romans „Never. Die letzte Entscheidung“ von Ken Follett (72) plötzlich nicht nur erschreckend aktuell, sondern ungemein bedrückend und beängstigend, obwohl dessen Schauplätze ganz andere sind. Der britische Bestseller-Autor schildert anschaulich und äußerst spannend, wie viele kleine politische Krisen, verursacht durch unüberlegtes, selbstherrliches und machtbesessenes Handeln von Diktatoren und Autokraten, sich langsam summieren, durch politische Aktion und Reaktion schrittweise eskalieren und schließlich in eine globale Apokalypse münden. 0 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 23.02.2022 | ||

|
REZENSION – Spätestens seit seinem vielgerühmten vierten Roman „Kalman“ (2020) weiß man, dass der seit 2007 in Island lebende Schweizer Schriftsteller Joachim B. Schmidt (41) sich in der Charakterisierung ungewöhnlicher, skurriler Figuren versteht. Äußerst ungewöhnlich ist auch der Protagonist seines neuen Romans „Tell“, im Februar beim Diogenes Verlag erschienen, in dem Schmidt es wagt, den Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell von seinem Sockel zu holen und ihn in einer spannenden Handlung statt eines heldenhaften Widerstandskämpfers gegen den Habsburger Landvogt als einen einfachen, recht eigenbrötlerischen, schon in Kinderjahren vom Schicksal geprägten Bergbauern, Wilderer und Querulanten im Kanton Uri zu schildern. Schmidts Tell ist wahrlich kein legendärer Held, sondern ganz im Gegenteil ein Antiheld, der eigentlich nur seine Ruhe und für sich und die Familie ausreichend zu essen haben will. |
|
| Bewertung vom 11.02.2022 | ||
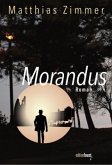
|
REZENSION – Mit seinem Roman „Morandus“, bereits 2021 in der Edition Faust erschienen, ist dem Autor Matthias Zimmer (60), der sich als Politikwissenschaftler, Hochschullehrer und langjähriger Bundestagsabgeordneter bislang auf politische Sachbücher beschränkt hatte, ein beeindruckendes erzählerisches Debüt gelungen. Dieses für ihn riskante Wagnis ging er nach eigener Aussage deshalb ein, „dass man manche Dinge erzählen muss, weil sie für eine wissenschaftliche Arbeit zu kompliziert sind“. Das Risiko hat sich gelohnt: Sein Roman, hauptsächlich die Schilderung eines Gesprächs zweier alt gewordener Freunde, gleicht einem ruhigen Kammerspiel. Doch obwohl die Handlung ohne Dramatik auskommt, baut sich in diesem klugen Gespräch und somit im Roman eine Spannung auf, die fasziniert und eine Unterbrechung der Lektüre fast verbietet. |
|
| Bewertung vom 10.02.2022 | ||

|
Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße REZENSION – Was ist Wahrheit? Wo beginnt Lüge? Oder gibt es alternative Wahrheiten? Darum geht es im satirischen Roman „Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße“ des in Ost-Berlin geborenen Schriftstellers Maxim Leo (52), im Februar beim Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Auch die deutsche Wiedervereinigung, Vorurteile und vermeintliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen und nicht zuletzt die Frage, wie historische Fakten interpretiert oder manipuliert werden können, werden angesprochen. |
|
| Bewertung vom 30.01.2022 | ||

|
REZENSION – Vor 75 Jahren erschien die zensierte Erstausgabe des Romans „Jeder stirbt für sich allein“ - nur wenige Wochen nach dem frühen Tod seines Autors, des deutschen Schriftstellers Hans Fallada (1893-1947), der eigentlich Rudolf Ditzen hieß. In seiner unzensierten Originalfassung wurde Falladas letztes, inzwischen in 30 Sprachen übersetztes Werk erstmals 2011 im Aufbau Verlag veröffentlicht. Von der Wiederentdeckung dieses zwischen 1962 bis 2016 fünf Mal verfilmten Bestsellers war der Frankfurter Journalist Oliver Teutsch (52) nach eigener Aussage so fasziniert, dass er schon 2014 begann, über die „Entstehung eines Weltbestsellers“ zu recherchieren, wie der Untertitel seines im Januar beim Axel Dielmann Verlag veröffentlichten Debütromans „Die Akte Klabautermann“ heißt. 2 von 2 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 27.01.2022 | ||

|
REZENSION – Wer Fallada liebt, muss Töteberg lesen; wer Fallada nicht kennt, erst recht. Auf den knapp 340 Seiten seiner im November im Aufbau Verlag erschienenen Romanbiografie „Falladas letzte Liebe“ über die knapp zwei letzten Lebensjahre des vor allem in der Weimarer Republik überaus erfolgreichen Autors fasst Michael Töteberg (71) unter Verwendung umfangreichen Archivmaterials alles zusammen, was Hans Fallada (1893-1947) in seinen Stärken und Schwächen als Mensch und vor allem als Schriftsteller so besonders macht. |
|