Insgesamt 210 Bewertungen
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 7 Zur Seite 7 8 Zur Seite 8 9 Aktuelle Seite 10 Zur Seite 10...Weitere Seiten21Zur letzten Seite, Seite 21Zur nächsten SeiteZur letzten Seite
Zur ersten SeiteZur vorherigen Seite...Weitere Seiten 7 Zur Seite 7 8 Zur Seite 8 9 Aktuelle Seite 10 Zur Seite 10...Weitere Seiten21Zur letzten Seite, Seite 21Zur nächsten SeiteZur letzten Seite



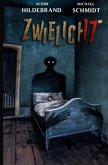

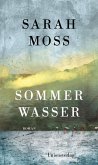

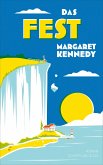

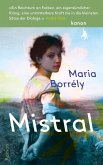
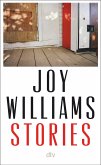
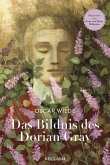

Benutzer