BenutzerTop-Rezensenten Übersicht

Bewertungen
Insgesamt 1245 Bewertungen| Bewertung vom 29.09.2017 | ||

|
Der Literaturwissenschaftler Jörg Krippen wird als Gastdozent nach London eingeladen. Schon bei der Ankunft in seiner Bleibe begegnet er einer jungen Frau, die zugleich etwas Bekanntes wie auch etwas Faszinierendes hat. Als sie in seinem Seminar auftaucht und ihn dann auch noch auf Deutsch anspricht, ist er mehr als verwundert, lässt sich aber auf eine Affäre ein. Bald schon muss er jedoch feststellen, dass sie sich nicht zufällig über den Weg gelaufen sind, sondern dass Mae dies alles geplant hat und ihn tatsächlich schon aus Berlin kannte. Berlin, seiner Heimat, wo auch seine Frau Sabrina und sein Sohn Leon sind und eigentlich das gemeinsame Leben stattfindet, aus dem sich Jörg gerade mehr und mehr flüchtet. Schnell entfremdet er sich von seinem alten Leben, doch die Vergangenheit holt ihn ein, eine Vergangenheit, die noch vor der mit Sabrina lag. |
|
| Bewertung vom 29.09.2017 | ||
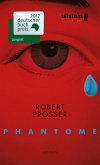
|
2015, Wien. Sara und ihr Freund kennen die Geschichte von Saras Mutter Anisa nur aus deren Erzählungen. Die Flucht aus Bosnien, wegen des Krieges aus der Heimat vertrieben. Der Konflikt, der plötzlich Nachbarn zu Feinden machte und Familien auseinanderriss. Die beiden Jugendlichen machen sich auf nachzuforschen, vor Ort, im Süden, da wo einst ein Land war und was inzwischen in unzählige Kleinstaaten zersplittet ist. Schnell wird das Leben von damals wieder lebendig und der Leser befindet plötzlich im Jahr 1992 und auf der Flucht vor dem Krieg. Anisa, die als Flüchtling hofft in Sicherheit zu kommen und ihr Freund Jovan, der von der Armee eingezogen werden soll und zwischen die Fronten gerät. Anisa kann die schrecklichen Kriegserlebnisse auch im fernen Wien nicht hinter sich lassen, die Ungewissheit, was mit dem Freund und dem Vater ist, lähmt sie immer wieder. Doch sie muss auch nach vorne blicken, sich in der Fremde ein neues Leben aufbauen – doch wie? |
|
| Bewertung vom 24.09.2017 | ||

|
Normalerweise habe ich eine recht feste Art, Rezensionen zu Büchern zu schreiben. Bei Thoms Lehrs Buch „Schlafende Sonne“ funktioniert dies nicht, mich hat aber auch selten ein Buch so ratlos am Ende zurückgelassen und auch schon beim Lesen verärgert. 1 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 18.09.2017 | ||
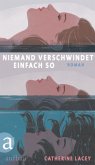
|
Niemand verschwindet einfach so Elyria tut das, wovon viele träumen, sich aber nie wagen in die Tat umzusetzen: sie verschwindet. Sie setzt sich in einen Flieger und reist von den USA nach Neuseeland. Sie weiß, wovor sie wegläuft, wohin sie will ist schon schwieriger. Zunächst einmal auf die Farm eines Mannes, den sie kennenlernte und der ihr leichtsinnigerweise anbot, bei ihm in der Abgeschiedenheit zu leben und arbeiten. Trampend bestreitet sie den Weg, Gelegenheitsjobs bringen immer wieder ein wenig Geld ein.- Was ihr Ehemann und ihre Mutter machen, interessiert sie nicht, das hat sie hinter sich gelassen. Was sie jedoch nicht zurücklassen kann, ist die Erinnerung, vor allem an ihre Stiefschwester, deren Tod sie nie überwunden hat. In der Ferne sucht sie nach etwas, sich selbst, und sie versucht ihrem alten Ich und all seinen Erinnerungen zu entkommen. |
|
| Bewertung vom 17.09.2017 | ||
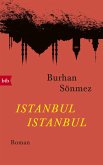
|
Istanbul, eine Gefängniszelle irgendwo unter der Stadt. Der Student Demirtay, der Doktor, der Babier Kamo und Küheylan Dayi werden in der zwei mal ein Meter großen Zelle unfreiwillig Schicksalsgenossen. Sie warten, nicht auf die Freilassung, damit rechnet keiner von ihnen, sondern auf die Wärter, bis diese zum nächsten Mal die Zelle aufschließen, einen von ihnen rausholen und wieder foltern. Dann warten sie, bis der Zellengenosse schwer verletzt zurückgeschleift und wieder zu ihnen geworfen wird. Es ist kalt da unten, sie haben kein Licht und nur wenig zu essen. Sie erzählen sich nichts von ihrem Leben, was sie in die Zelle geführt hat, das wäre zu gefährlich, denn schon bei der nächsten Befragung könnte einer der Mithäftlinge etwas preisgeben. Also verbringen sie ihre Zeit mit dem Geschichtenerzählen, wie es seit Menschengedenken Tradition ist, um die Zeit des Wartens zu verkürzen. |
|
| Bewertung vom 16.09.2017 | ||
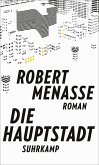
|
Eine neue Sau wird durchs Dorf getrieben – oder so ähnlich. Ein Schwein, Mitten in Brüssel, der europäischen Hauptstadt. Die Gemüter sind erregt, die Gazetten stürzen sich auf das Thema. Derweil plagen die Beamten der Europäischen Kommission ganz andere Sorgen als Schweine auf Brüssels Straßen. Schweineohren sind interessant, aber nur, weil man damit auf dem chinesischen Markt Geld verdienen kann und aktuell die Nationalstaaten im Alleingang mit dem asiatischen Riesen verhandeln und sich gegenseitig reihenweise ausbooten und schaden. Ist das im Sinne der EU? Die könnte etwas für ihr Image tun, da kommt Fenia Xenopoulou das Big Jubilee Project gerade recht. Außerdem könnte das ihr Sprungbrett in ein wichtiges Ressort sein, Kultur ist mehr so das Abstellgleis. Apropos Gleis, als Kind ist David de Vries von einem Zug gesprungen, einem Deportationszug nach Auschwitz, der ihn in den sicheren Tod befördern sollte. Sein Leben lang war er Zeuge dessen, was Hass und Nationalstolz verursachen können, doch jetzt kann er sich kaum mehr erinnern, was er zehn Sekunden zuvor noch gedacht hat. Sein geistiges Erbe droht zu verfallen. Ähnlich verfällt auch der Körper von Kommissar Brunfaut, der eigentlich einen Mord aufklären will, den es aber plötzlich nicht mehr gegeben haben soll und der ihm einen unplanmäßigen Urlaub einbringt. Sie alle haben das Schwein gesehen, wie viele andere in der Hauptstadt der derzeit unpopulären Union, ein Schwein, über das alle reden und das die Leute in der Suche nach einem Namen zusammenführt und so wenigstens in einem Thema vereint. 5 von 6 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 16.09.2017 | ||
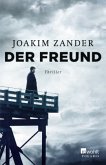
|
Der Freund / Klara Walldéen Bd.3 Klara musste ihren geliebten Großvater beerdigen, ihre Freundin Gabriella ist wie immer an ihrer Seite. Doch Gabriella ist abgelenkt, irgendetwas belastet sie. Am nächsten Morgen wird sie vor den Augen Klaras in ihrer Kanzlei verhaftet. Diese agiert schnell und kann eine geheime Nachricht der Freundin entdecken: sollte Gabriella etwas geschehen, muss Klara einen geheimen Informanten in Brüssel treffen. Dieser ominöse Mensch ist ein Praktikant der schwedischen Botschaft in Beirut. Jacobs Zeit dort ist geprägt von Langeweile im Büro und umso mehr Aufregung durch seinen Freund und Liebhaber Yassim. Dieser gibt kaum etwas von sich preis, verschwindet immer wieder für Wochen spurlos und trifft sich mit zwielichtigen Personen. Jacob ahnt selbst, dass mit Yassim etwas nicht stimmt, als er von einer mysteriösen Frau kontaktiert wird, die behauptet, dass Yassim ein Terrorist sei, weiß er nicht mehr, was er glauben soll. Doch dass er sich in größte Gefahr begeben hat, wird Jacob nicht erst klar, nachdem seine Wohnung verwüstet wurde und sein Leben bedroht wird. Helfen kann ihm wohl nur die Frau, die er Monate zuvor im Fernsehen bewundert hat: Gabriella. |
|
| Bewertung vom 13.09.2017 | ||

|
Ein Schriftstellertreffen führt den Autor Kurt Prinzhorn nach Innsbruck in ein kleines Hotel. Dort trägt sich eine seltsame Begebenheit zu: erst findet er in seinem Badezimmer schwarze Frauenhaare, die vorher sicher nicht da waren, dann verschwinden sein Schlüsselbund und seine Notizbücher. Die Tür wurde aber gemäß der Chipkartenauslese nur von ihm selbst bedient. Der Fall bleibt unerklärlich und fesselt auch die anderen Literaten ob der Kuriosität. Wenige Tage später muss Prinzhorn für eine Lesung nach Moskau reisen. Dort hat er ebenfalls seltsame Erlebnisse, die sich nicht nur durch die fremde Kultur erklären lassen. Langsam fühlt sich Prinzhorn verfolgt, zudem macht er sich Sorgen, was der Eindringling mit seinen Schlüsseln anstellen könnte. Wieder in Deutschland stellt er jedoch fest, dass in sein Haus offenbar nicht eingebrochen wurde. Seine dritte Reise innerhalb weniger Wochen führt ihn schließlich nach Madrid, wo ihn abermals der Verdacht beschleicht, verfolgt zu werden. Seine Aufmerksam ist geschärft und tatsächlich soll er recht behalten. Er wird beschattet und die Person, die ihm nachstellt, sinnt auf Rache. |
|
