BenutzerTop-Rezensenten Übersicht

Bewertungen
Insgesamt 1245 Bewertungen| Bewertung vom 26.08.2017 | ||

|
Er hat sich gut gehalten, richtig fit ist er für seine 68 Jahre. Doch bei einer Routineuntersuchung findet seine Ärztin da etwas; muss nicht schlimm sein, bestimmt operabel, weitere Tests sollen Klarheit bringen. Walter Nowak macht weiter, wie jeden Morgen geht er schwimmen, zieht konsequent seine Bahnen, der Fitness wegen. Doch eine Frau lenkt ihn ab, erinnert ihn an seine zweite Ehefrau Yvonne, noch vor wenigen Jahren hatte sie auch noch so einen Pferdeschwanz – und schon passiert es: Walter Nowak schlägt mit dem Kopf am Beckenrand ein. Ein harter Schlag, der ihn aus der Bahn wirft. Kurz danach ist er bewusstlos am Badezimmerboden, was ist passiert? Erinnerungsfetzen durchziehen seinen Alltag, Erinnerungen an die Zeit mit Gisela, seiner ersten Frau; den gemeinsamen Sohn Felix, von der Schule geflogen wegen Drogenhandels; seinen Job – und immer wieder wacht er auf und findet sich in einer Situation wieder, von der er nicht weiß, wie er überhaupt in sie geraten ist. Gerade eben war er noch völlig gesund und fit und nun scheint er die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. |
|
| Bewertung vom 26.08.2017 | ||

|
Die Geschichte der getrennten Wege / Neapolitanische Saga Bd.3 Italien, 1970er Jahre. Elena Grecos Buch wird ein großer Erfolg in Italien, selbst im Rione hat man es gelesen und die Leute schwanken zwischen Bewunderung und Ablehnung ob der für ihr Empfinden expliziten Szenen. Nur Lila will der Freundin keine Anerkennung zollen. Sie ist jedoch auch zu sehr mit dem eigenen Überleben beschäftigt, nachdem sie sich von ihrem Mann getrennt hat und in einer Wurstfabrik schuftet. Die Strömungen der Zeit machen auch vor Neapel nicht Halt und die Gewerkschaften werden zunehmend stärker. Lila liefert ihnen Futter und bringt sich damit in höchste Gefahr. Auch Elena lässt sich von der Kampfeslust anstecken und schreibt erfolgreich über die Ausbeutung und schlechte Behandlung der Arbeiter, doch schon kurz nach ihrer Hochzeit mit Pietro ändert sich ihr Leben vollends: ungewollt schwanger wird sie mehr und mehr in das Leben einer Hausfrau und Mutter gedrängt, das an ihren Nerven zerrt und sie vom Schreiben abhält. Während ihrerseits Lila nun ihre Karriere als Programmiererin vorantreibt, geht Elenas Stern langsam unter. Der Rione versinkt im Chaos von Gewalt und Korruption, keine Familie kann sich dem Supf entziehen, nur Elena bleibt fernab der Heimat Zaungast. Und plötzlich tut sich die Chance zum Ausbruch aus dem inzwischen verhassten Leben auf. |
|
| Bewertung vom 23.08.2017 | ||
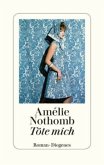
|
Jugendlicher Leichtsinn oder doch ein Zeichen für ihren schlimmen Zustand? Der Graf Neuville muss seine Tochter Sérieuse bei einer Wahrsagerin abholen, nachdem diese das Mädchen völlig durchgefroren nachts im Wald auffand. Zum Abschied prophezeit sie dem Vater, dass er bei einem Empfang einen seiner Gäste töten werde. Die beeindruckt Neuville zunächst nur mäßig. Geldsorgen plagen ihn und am 4. Oktober 2014 wird seine letzte große Garden Party im Château du Pluvier steigen, bei der alles perfekt sein muss. Danach wird das Schloss veräußert und die Familie sich in ein kleineres Domizil zurückziehen. Doch die Voraussagungen der Frau lassen ihm keine Ruhe. Vielleicht wäre es besser, sich auf das Ereignis vorzubereiten. So beschließt er eine Liste derjenigen Gäste zu machen, der Tod nicht nur verzeihlich, sondern sogar wünschenswert wäre. Bald hat er auch einen passenden Kandidaten ausgemacht. Doch dann überrascht ihn Sérieuse mit einem Vorschlag: er solle sie doch töten. Seit fünf Jahren bereits ist sie unglücklich und hat den Eindruck, nie mehr etwas fühlen zu können. Der Tod wäre eine Erlösung und durchaus in klassischer Tradition und somit verzeihlich. Wie kann der Graf aus dieser unsäglichen Geschichte entkommen? |
|
| Bewertung vom 21.08.2017 | ||
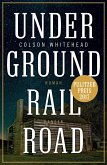
|
Georgia, Anfang des 19. Jahrhunderts. Cora lebt als Sklavin auf der Randall Farm, dort ist sie geboren, etwas anderes als die harte Arbeit und die schrecklichen Strafen kennt sie nicht. Ihrer Mutter ist vor Jahren die Flucht geglückt, was das Leben für Cora nicht einfacher macht. Nachdem sie sich einer Gruppe Männer erfolgreich zur Wehr gesetzt hat, gehört sie zu den ausgestoßenen Frauen, was ihr aber die Möglichkeit eines halbwegs friedlichen Lebens eröffnet. Als Caesar sie zum ersten Mal wegen einer möglichen Flucht anspricht, lehnt sie ab. Schon ihre Großmutter hatte das zugeteilte Schicksal widerspruchslos ertragen. Doch die Situation auf der Farm ändert sich und so stimmt Cora schließlich doch zu, auf das geheime Netzwerk der Underground Railroads zu vertrauen und die gefährliche Flucht zu wagen. Die nächsten Monate wird sie in Angst leben, mal mehr mal weniger, weite Teile der USA kennenlernen, von Freiheit träumen und doch immer wieder an ihre Herkunft erinnert werden. Wird die junge schwarze Frau jemals dem ihr zugeschriebenen Los endgültig entkommen können? 0 von 1 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. |
|
| Bewertung vom 18.08.2017 | ||
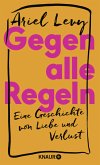
|
Ariel Levy ist eine erfolgreiche Journalistin, deren Leben offenbar aufregend und glücklich ist. Doch hinter der öffentlichen Fassade sieht vieles anders aus, als man erwarten könnte. In ihrem Buch „Gegen alle Regeln“, das auf einem Artikel basiert, der bereits 2013 im New Yorker erschienen ist, zeichnet sie ihren Weg bis zum völligen Kollaps ihres Lebens nach. Ihre Kindheit, in der sie schon früh von den starken Mädchen- und Frauenfiguren fasziniert war und bereits im Grundschulalter den Wunsch entwickelte, Journalistin zu werden. Ihre Anfänge im der Zeitungsbranche, die von Sexismus geprägt war und jungen Kollegen kaum Chancen bot. Daneben ihr Privatleben, für das die gängige Vorstellung einer heterosexuellen Monoehe nicht funktionierte; wechselnde Partner, männlich wie weiblich, bis sie schließlich in Lucy ihre Lebenspartnerin gefunden zu haben scheint. Doch auch diese Verbindung muss Höhen und Tiefen durchleben und mit Mitte 30 drängt sich die Frage nach Kindern immer mehr auf. Die Schwangerschaft verläuft zunächst glücklich, die Freude über das Kind ist groß, doch dann kommt es fernab der Heimat zu einer Notgeburt, die das Baby nicht überlebt und Ariel völlig aus der Bahn wirft. |
|
| Bewertung vom 16.08.2017 | ||

|
Finding a house in London is more or less impossible; therefore, Sydney and Jack are happy when they finally get one. It is not what they have dreamt of, but, with the time, they became realistic about what is possible and accepted the offer. Soon after they move in, strange things start to happen and they become more and more alert: is the house haunted or is somebody playing tricks on them? Is it because they interfered with the neighbour? His daughter confided herself in Sydney and awoke bad memories in her: just like Betsi, Sydney was suffering under her father’s temper and violence throughout her childhood. Unable to find help, she ran away at the age of 14 and left her younger sister with the situation at home alone. A bad conscience makes Sydney support the young neighbour, but obviously, her father is going to stop this. Or is the threat coming from somewhere completely different? No matter what is behind, soon Sydney and Jack find themselves in danger and even start losing faith in each other. |
|
| Bewertung vom 15.08.2017 | ||
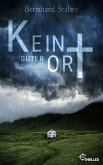
|
Eine gelungene Festnahme eines gesuchten Verbrechers bringt Kari Bergland auch mit Janne, der Tochter ihres Vorgesetzten In Verbindung. Diese ist offenkundig schwer drogenabhängig und therapiebedürftig. In Bergen wird das nur schwer zu realisieren sein, daher schlägt Kari vor, Janne zum Psychologen Arne Eriksen zu bringen, der der Polizei in der Vergangenheit bereits wiederholt geholfen hat und nun in Südnorwegen praktiziert. In der Nähe seiner neuen Heimat befindet sich auch die sogenannte Rabenschlucht, ein unheimlicher Ort, der heute nur noch ein verlassenes Hotel beherbergt, in dem zehn Jahre zuvor ein junges Mädchen und ihr Vater unter mysteriösen Umständen ums Leben kamen. Janne ist ebenfalls sofort fasziniert von diesem verwunschenen Ort und begibt sich in größte Gefahr. Offenbar haben sie schlafende Geister geweckt, die noch nicht mit der Vergangenheit abgeschlossen haben. |
|
| Bewertung vom 12.08.2017 | ||
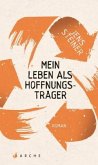
|
Mein Leben als Hoffnungsträger Nachdem er seine Mechatronikerlehre abgebrochen hat, taumelt Philipp etwas planlos durchs Leben. Aus seiner WG ist er ebenfalls geflogen, sein Putzfimmel hat die Mitbewohner so sehr unter Druck gesetzt, dass sie im Rauswurf den einzigen Ausweg sahen. Eines Tages spricht ihn Uwe an und zeigt ihm den städtischen Recyclinghof, den er leitet. Philipp findet wieder Erwarten in dem ernsten Uwe, der Recycling als nicht nur wichtige, sondern auch sehr ernsthafte Sache begreift, seinen Mentor und mit den beiden portugiesischen Mitarbeitern João und Arturo zwei angenehme wenn auch eigenwillige Kollegen. Sein Leben gewinnt einen neuen Rhythmus und die kleine Zweckgemeinschaft wird bald durch ein aus dem Ruder laufendes Nebengeschäft Joãos auf eine ernste Probe gestellt. |
|
