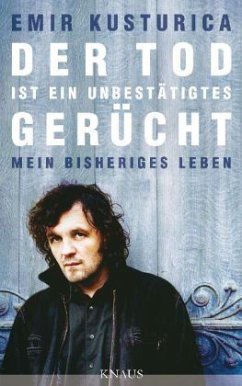Von seinen Filmen sagt man, die Bilder und Töne würden in Ewigkeit überdauern. Emir Kusturica, der gelegentlich den Mund recht vollnimmt, traut dieser Einschätzung nicht und schreibt vorsichtshalber seine Erinnerungen auf: beginnend an seinem ersten Schultag, als Juri Gagarin ins All flog, bis zu dem Tag, als Johnny Depp sein Freund wurde. Er folgt der Chronologie, aber das ist auch alles, was das Buch mit einer normalen Lebensgeschichte gemein hat.
"Der Tod ist ein unbestätigtes Gerücht" ist ein Gesamtkunstwerk, das genau die Bilder erschafft, die man von Kusturica kennt: wilde Geschichten vom Balkan, quirlig, heiter, sentimental, brutal. Sein Buch ist ein adaptierter Autorenfilm, der die gedrehten und ungedrehten Szenen eines Lebens vorführt. Die Geschichte vom unglücklichen Alkoholiker in Sarajewo, der mit einer Prostituierten verheiratet ist und dann erfriert. Die Geschichte von dem Psychiater, der Kusturica in einer Schaffenskrise helfen soll und dann selbst Trost braucht. Die Geschichte von der Frau seines Lebens. Die Geschichte vom Urknall der Begegnung mit Tante Biba, später dann mit Federico Fellini und Ivo Andric Tränen und Gelächter über eine wahnwitzige Welt. Ein Tagebuch wie es dem Nachkommen des Gottes Dionysos würdig ist. Obwohl er doch lediglich, weist Kusturica die Übertreibung zurück, "der Sohn des Vaters von Dionysos" sei.
"Der Tod ist ein unbestätigtes Gerücht" ist ein Gesamtkunstwerk, das genau die Bilder erschafft, die man von Kusturica kennt: wilde Geschichten vom Balkan, quirlig, heiter, sentimental, brutal. Sein Buch ist ein adaptierter Autorenfilm, der die gedrehten und ungedrehten Szenen eines Lebens vorführt. Die Geschichte vom unglücklichen Alkoholiker in Sarajewo, der mit einer Prostituierten verheiratet ist und dann erfriert. Die Geschichte von dem Psychiater, der Kusturica in einer Schaffenskrise helfen soll und dann selbst Trost braucht. Die Geschichte von der Frau seines Lebens. Die Geschichte vom Urknall der Begegnung mit Tante Biba, später dann mit Federico Fellini und Ivo Andric Tränen und Gelächter über eine wahnwitzige Welt. Ein Tagebuch wie es dem Nachkommen des Gottes Dionysos würdig ist. Obwohl er doch lediglich, weist Kusturica die Übertreibung zurück, "der Sohn des Vaters von Dionysos" sei.

Der Regisseur Emir Kusturica erzählt sein Leben
Allein wegen seiner Filme muss man Emir Kusturica mögen. "Time of the Gypsies", "Schwarze Katze, weißer Kater" oder "Das Leben ist ein Wunder" sind dionysische, vor Lebenslust überbordende Erzählungen; die Menschen darin sind liebenswert skurril und exzentrisch. So wie der Regisseur aus Sarajevo, der im Übrigen zweimal die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Er ist nebenher auch Bassist in einer Gypsy-Punkrock-Band, Gründer eines Aussteigerdorfes in den serbischen Bergen und ein erklärter Gegner der Konsumgesellschaft. Ein sympathischer Typ, könnte man meinen.
Leider sind seine politischen Ansichten mindestens ebenso exzentrisch. Mittlerweile hat Kusturica es geschafft, sich inner- und außerhalb des Filmbetriebs zur Persona non grata zu machen: Er demonstriert gegen die Unabhängigkeit des Kosovo und lässt seine Band The Non Smoking Orchestra Texte singen wie "Wer Raso Dabic nicht liebt, kann uns mal" (Dabic war der Deckname des angeklagten Kriegsverbrechers Radovan Karadzic). Vielen gilt Kusturica als serbischer Nationalist, der sich mit Milosevic solidarisiert hat.
Wer also ist Emir Kusturica, 57, fragt man sich - und hofft, dass seine kürzlich auf Deutsch erschienene Autobiographie einem mehr darüber verrät. "Der Tod ist ein unbestätigtes Gerücht" heißt sie, und so schön der Titel klingt, so wenig erklärt sie einem die Widersprüche. Denn Kusturica hat nicht an einer politischen Rehabilitierung oder Klärung gearbeitet, sondern an einer belletristischen Version seiner Filme. Im Mittelpunkt des Buches steht ein Junge an der Schwelle zum Erwachsenenalter, dessen Heranreifen in allerlei kuriosen Anekdoten erzählt wird. Zum Beispiel, wie der achtjährige Emir jeden Abend um halb sieben auf die Straße läuft, um seine erste Liebe zu küssen. Snjezana heißt sie, "die Schneebedeckte", und sie erinnert in ihrer Märchenhaftigkeit an Ida aus "Schwarze Katze, weißer Kater" oder an Jasna aus "Versprich es mir". Überhaupt wirken viele Szenen wie Episoden aus Kusturicas Filmen, und er reiht sie in einer Art und Weise aneinander, dass der Leser die filmischen Überblendungen gleichsam mitliest.
Die Welt, die er beschreibt, ist ebenso absurd-komisch wie in seinen Filmen. In einem Moment streiten sich alternde Männer fast handgreiflich darüber, ob Titos Haare mit Henna oder Schuhcreme gefärbt seien; im nächsten Moment stirbt der Großvater - oder eigentlich auch nicht, denn "das Leben hat ihn nur ins Jenseits geschickt, damit er sich dort von seiner Güte erholt". Es ist ein Buch voller Skurrilitäten, voller Sympathie für die menschliche Irrationalität. Vergeblich aber wartet man auf einen Einblick in die Gedankenwelt von Emir Kusturica, dem politischen Hasardeur.
Auch wenn er gegen Ende des Buches das Anekdotenhafte hinter sich lässt und die politischen Ereignisse in Jugoslawien zu Beginn des Balkankonflikts in den Fokus rückt, bleibt seine Haltung uneindeutig. Die einzige Stellungnahme sind Anklagen gegen "die Kriegshetzer", zu denen er alle Teile des einstigen Vielvölkerstaates mit Unabhängigkeitsbestrebungen zählt - außer dem serbischen. Das ist nicht gerade neu, und deswegen ist die Autobiographie auch keine Quelle der Erkenntnis - umso weniger, als sie zwar im Jahr 2010 erschienen ist, aber nicht über die neunziger Jahre hinausreicht. Damit entfallen sämtliche Ereignisse der letzten Zeit, wie zum Beispiel Kusturicas Übertritt zum orthodoxen Glauben (den viele politisch interpretiert haben, als Abkehr vom bosnisch-islamischen Glauben hin zum serbischen Christentum), die Auftritte mit seiner Band und die Demonstrationen gegen die Unabhängigkeit des Kosovo.
Im Gespräch versucht Kusturica immerhin eine Erklärung: Er habe sehr darunter gelitten, das Buch zu Ende zu schreiben, und für diesen schwierigsten Teil habe er keine Energie mehr gehabt. Spricht man ihn auf den Vorwurf des serbischen Nationalismus an, redet Kusturica sich in Rage: "Ich würde mich nicht als Nationalisten bezeichnen, sondern als Antiimperialisten. Man muss kein Serbe sein, um zu sehen, wie ungerecht die Kriegsökonomie ist. Für die Unabhängigkeit des Kosovo zu sein ist unehrlich. Unabhängigkeit für das Kosovo würde bedeuten, dass man das Land dieser illegalen kriminellen Gruppe überließe, die es momentan regiert. Du musst kein Nationalist sein, du kannst auch ein Skinhead sein oder Naomi Klein, um das zu sehen."
Im Buch gibt es eine Szene, in der seine Mutter ihn fragt, warum er für einen seiner Filme finanzielle Hilfe vom staatlichen Sender RTS angenommen habe, der damals vom Milosevic-Regime kontrolliert wurde. Kusturica antwortet: "Weil ich ein politischer Idiot bin." Für das Eingeständnis eines Irrtums sollte man das nicht halten. Im Gegenteil: "Ich mag es, ein politischer Idiot zu sein. Denn wenn du politisch korrekt bist, bist du ein verdammter unmoralischer Bastard." Eine klare Distanzierung von Milosevic wird man von ihm auch nicht hören. Er sagt lediglich, er sehe es nicht ein, sich von den Medien und anderen, die ihm die Rolle des Verräters aufgezwungen hätten, zum Gejagten machen zu lassen. Klüger ist man nach dem Gespräch so wenig wie nach der Lektüre.
Was also tun? Vom "politischen Idioten" absehen und sich weiter seine Filme ansehen? Womöglich verhält es sich ja so, dass Kusturicas Filme ihn beim Schreiben seiner Autobiographie inspiriert haben - und nicht die Erfahrungen seines Lebens seine Filme. Dann könnte auch die Person, die er im realen Leben verkörpert, eine Figur aus seinen Filmen sein: im Grunde sympathisch, aber leider politisch ziemlich irregeleitet. Und Emir Kusturica wäre dann der Mann, der sein Werk mit seinem Leben verwechselt hätte. Oder umgekehrt.
MIRKA BORCHARDT
Emir Kusturica: "Der Tod ist ein unbestätigtes Gerücht. Mein bisheriges Leben". Knaus-Verlag, 352 Seiten, 19,99 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Mathias Schnitzler kennt sie alle, die politischen Verirrungen des Emir Kusturica, seine Treueschwüre gegenüber dem serbischen Präsidenten Milosevic und seine Huldigung des Kriegsverbrechers Radovan Karadzic. Aber den Regisseur liebt er trotzdem, für all seine "irrwitzen, poetischen Filme" wie "Zeit der Zigeuner" oder "Schwarze Katze, weißer Kater". In dieser Autobiografie hat Schnitzler nun erlebt, dass das reale Familiensetting bei Kusturica genauso verrückt ist wie seine Filme, Schnitzler schwärmt jedenfalls von einer "durch und durch schrägen Sippe". Mit ebenso großer Erheiterung hat er die Passagen gelesen, in denen Kusturica von seinen Kiffernächten mit Johnny Depp durchs belagerte Sarajevo erzählt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH