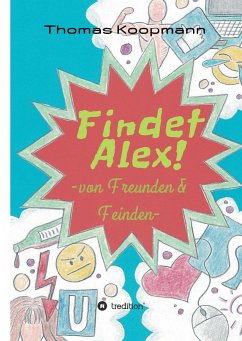Zeitgeist ist sein zweiter Name: Mit rasender Energie erzählt Jarett Kobek in seinem Roman, was das Internet mit uns macht. San Francisco: Eine Gruppe von Freunden kollidiert hart mit der digitalen Gegenwart. Adeline hat nach einer unbedachten Äußerung zu Beyoncé und Rihanna einen Shitstorm am Hals, und Ellen findet sich nackt im Netz. Die Kampfzone hat sich verschoben, und wir selbst haben die Munition geliefert: Warum geben wir unsere Daten her? Machen Apple und Google zu den mächtigsten Playern der Welt? Hier ist sie endlich: Eine "raue Tirade zu Politik und Kultur, ein Aufschrei zu Macht und Gewalt in unserer globalisierten Welt" (New York Times). Für alle, die Dave Eggers 'Circle' und Michel Houellebecqs 'Unterwerfung' geliebt haben - plus eine Prise Wahnsinn obendrauf.

Schlechter Roman mit Ansage: Jarett Kobeks Nerd-Kritik "Ich hasse dieses Internet" wird vorgetragen im Gestus eines Supercheckers und offenbart weder große Sachkompetenz noch sprachlichen Glanz.
Ich hasse dieses Internet" ist, wenn überhaupt, ein schlechter Roman. Jarett Kobek nennt seinen Erstling selbst etwas euphemistisch "verpeilt, sprunghaft, albern, blöd, schrullig, verrückt, zerstreut, aufgeblasen". "Gute Romane" sind für ihn ein Relikt des Kalten Kriegs, von der CIA erfunden, um mit öden Geschichten über das Sexleben weißer Männer der gehobenen Mittelschicht den Kommunismus zu destabilisieren. Kobek, ein zwischen kalifornischer Techie-Szene und East-VillageBoheme pendelnder schwuler jüdischer Autor, lässt sich nicht ins Great-American-Novel-Programm des CIA einspannen. Er hasst alle Formen von Sexismus, Rassismus und WASP-Ignoranz, er hasst das Internet, die Google-Busse und die Gentrifizierung von San Francisco. Er nennt bei jeder Figur politisch korrekt den Eumelaningehalt "in der Basalschicht ihrer Epidermis" und macht Nerd-Witzchen über neomaoistische Cyberpunks und Computerviren mit Alkoholproblemen. Das hält er offenbar für irre lustig oder jedenfalls für postpost-"ironisch".
Kobeks Buch ist so hyperaktiv, redundant und wirr wie der Blog eines Internettrolls. Es wimmelt nur so von enzyklopädisch-besserwisserischen Definitionen, Promiklatsch, Verschwörungstheorien und Selfies als verkanntes Genie. Eigentlich ist es kein Roman, sondern eine im erzählerischen Präteritum verfasste Hassmail, eine längliche Wutpredigt gegen die kalifornische Ideologie. Kobek schimpft auf Amazon und Facebook, Steve Jobs und Mark Zuckerberg, Rihanna und Alan Greenspan, auf Fastfood und Finanzkrise. Und natürlich aufs Internet. Das Internet ist "ein Computernetzwerk, das Menschen dazu nutzen, andere Menschen daran zu erinnern, dass sie ein mieses Stück Scheiße sind", ein "hervorragendes Instrument, um Kinderpornos, gestohlene Autopsieberichte und Raubkopien von europäischen Horrorfilmen aus den Siebzigern zu verbreiten". Die Ideologen des Silicon Valley faselten von Meinungsfreiheit, Demokratie und Zukunft. Aber das Internet habe noch nie etwas Großes, Schönes und Wahres hervorgebracht, nicht den arabischen Frühling und schon gar nicht die versprochene bessere Welt. Es sei nur eine scheinheilige Geldmaschine, der digitale Verblendungszusammenhang, der alle menschlichen Lebensäußerungen in Werbung, Konsum und Profit verwandelt.
Im Internet gehe es um die unbezahlte Aneignung fremder Arbeit, Meinungen und Emotionen durch große Konzerne. Es erniedrige die Menschen zu "stammelnden Katzbracken", die sich gegenseitig erniedrigen. Youtube und Twitter zum Beispiel seien Plattformen, auf denen "machtlose Menschen andere machtlose Menschen" fertigmachen, Teenager andere Teenager in den Selbstmord treiben, wenn sie nicht gerade Fotos von ihrem Mittagessen oder dem neuesten Fauxpas einer semiprominenten Eintagsfliege austauschen. Das iPhone sei ein von Sklaven zusammengebautes Verdummungsgerät, Instagram eine "endlose frigide Orgie" von Konsumartikeln, Katzen, Brustimplantaten und Tätowierungen.
Gepflegte Skepsis wie wütende Hasstiraden gegen "dieses Internet" sind nicht gerade originell. Die Schaufenster der Buchläden sind voll von Pamphleten, in denen Neurologen, Philosophen, Mediziner, besorgte Pädagogen und Anonyme Eklektiker mit den Hirn und Moral erweichenden, Klima und Familien zerstörenden Folgen der Online-Sucht ins Gericht gehen. Was Kobeks Roman vor derlei apokalyptischen Warnungen auszeichnet und gleichzeitig so nervt, ist die Arroganz des Supercheckers: "Ich weiß, wie das Internet war, bevor Menschen damit Geld verdienten. Ich bin der einzige Schriftsteller in Amerika, der tatsächlich Ahnung von Technik hat!"
Das mag sein, aber Kobeks Roman offenbart weder besondere Sachkompetenz noch sprachlichen Glanz. Stattdessen: schlichte, an analoge Kalenderweisheiten erinnernde Sprüche ("Das Räderwerk des Kapitalismus kann man nicht aufhalten. Aber man kann das nervige Körnchen Sand im Getriebe sein"), kurze, apodiktische Sätze, Listen, ad hoc neu erfundene Privatwörter wie "gootbluck", "Kackoblem" oder "reproten". Der digitale Prophet verkündet seine Wahrheiten von den Twin Peaks in San Francisco herab wie Moses seine Zehn Gebote vom Berg Sinai: "Das Internet ist das letzte Gefecht des Patriarchats. Hier schlagen Heteromänner ihre letzte Schlacht."
Kobek äußert in seiner Sammlung von Glossen, Theorien und Urteilen über Lieblingsthemen des Internet-Diskurses zu allem eine Meinung, was sich in Twitterlänge sagen lässt: Miley Cyrus sei eine lächerliche Schnepfe, Ayn Rand die graue Eminenz neoliberaler Risikokapitalisten, David Foster Wallace ein langweiliger "sexistischer Sportler". Der Plot in Kobeks "nützlichem Roman" ist Nebensache, die Figuren sind fast durchweg Doppelgänger des Autors. Mit J. Karacehennem etwa teilt er das Namensinitial, die türkische Abstammung und eine frühe Erzählung über den 9/11-Attentäter Mohammed Atta, mit dem Schriftsteller Baby das Faible für ältere Science-Fiction und Fantasy, mit Adeline, einer semiprominenten Comiczeichnerin, die durch unvorsichtige Bemerkungen über Beyoncé in einen Shitstorm gerät, das polyamouröse Sexleben und das Schicksal, neomarxistisch inspirierte Angehörige des kalifornischen Kreativprekariats zu sein. Wie übrigens auch die geheime Hauptfigur des Romans: Jack Kirby, der geniale Erfinder von "Hulk" und "Captain America", der vom Marvel-Konzern und Hollywood übel abgezockt wurde.
Kobek kann sich eigentlich nicht beklagen: Virales Marketing machte seinen Roman zum Kultbuch. Vierzehn Monate lang bot er das Manuskript wie Sauerbier an, bevor er es bei einem kleinen Verlag unterbrachte. Als die "New York Times" es dann hymnisch rezensierte ("Gehen Sie einen Tag offline, und lesen Sie dieses Buch"), ging es plötzlich schnell. Kobeks Internet-Bashing galt auf einmal als cooler "Aufschrei gegen Macht und Gewalt in unserer globalisierter Welt". Kenner wie Jonathan Lethem verglichen es sogar mit Houellebecqs "Unterwerfung", Dave Eggers "Circle" und Thomas Pikettys "Kapital". Mit Eggers' Dystopie mag Kobeks Nerd-Tirade tatsächlich einiges gemein haben, aber an Pikettys analytische Schärfe und Houellebeqs gleichmütig-heiteren Sarkasmus reicht sie nie heran: Man kann den Schwach- und Dumpfsinn des Internets nicht mit dessen eigenen Waffen schlagen.
MARTIN HALTER
Jarett Kobek: "Ich hasse dieses Internet". Ein nützlicher Roman.
Aus dem Amerikanischen von Eva Kemper. Verlag S. Fischer, Frankfurt 2016. 364 S.,
geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
Weniger als einen Roman denn als dreihundertseitigen Wutausbruch bringt Wieland Freund uns dieses Buch nahe, in dem Jarett Kobek eine wilde Attacke gegen das Internet und seine Freunde reitet. Das Internet ist für ihn etwas, in dem einige wenige Großkonzerne jeden Inhalt zu einem Werbeumfeld degradieren. Freund muss ziemlich viel lachen bei der Lektüre, auch dass Kobek den Captain-America-Erfinder Jack Kirby zu seinem Helden und ersten Opfer einer skrupellosen Content-Industrie macht, findet die Sympathie des Rezensenten. Am besten gefällt ihm aber, wie sich Kobek erst die politisch korrekte Mehrheitsgesellschaft ins Boot holt, um dieses dann "lustvoll zum Sinken" zu bringen": Nämlich wenn er über die Sprachverbote und die neue Religiosität herzieht, auf die sich Amerikas Linke beschränkt, anstatt politische und ökonomische Mechanismen in den Blick zu nehmen. Für Freund das Buch zur Zeit.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Das ganze Internet feiert schon diesen Tobsuchtsanfall gegen das Internet (und alles andere) [...] Eine Art Feel-good-Roman für Pessimisten Harald Staun Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 20160710