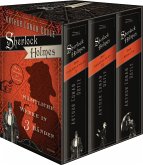»Sie dichtete ihr Leben, und sie lebte ihre Dichtung.« Marcel Reich-Ranicki
Diese Edition ist die erste kommentierte Werkausgabe Mascha Kalékos. Sie macht das Gesamtwerk und die Korrespondenz der Dichterin erstmals einem breiten Publikum zugänglich. Die zu Lebzeiten und im Nachlass veröffentlichten Werke der Schriftstellerin werden um Zeitungspublikationen und die unveröffentlichten Schriften aus dem Nachlass ergänzt. Mascha Kalékos Briefe zeigen eindrucksvoll die literarische Entwicklung der Autorin, aber auch die Dichterin als Privatperson - als Ehefrau, Mutter und Freundin. Ihr regelmäßiger intellektueller Austausch mit Schriftstellerkolleginnen und -kollegen wie Ingeborg Drewitz, Hilde Domin, Hermann Kesten, Walter Mehring, Kurt Pinthus und vielen anderen liefert kostbare literaturgeschichtliche Dokumente.
Diese Edition ist die erste kommentierte Werkausgabe Mascha Kalékos. Sie macht das Gesamtwerk und die Korrespondenz der Dichterin erstmals einem breiten Publikum zugänglich. Die zu Lebzeiten und im Nachlass veröffentlichten Werke der Schriftstellerin werden um Zeitungspublikationen und die unveröffentlichten Schriften aus dem Nachlass ergänzt. Mascha Kalékos Briefe zeigen eindrucksvoll die literarische Entwicklung der Autorin, aber auch die Dichterin als Privatperson - als Ehefrau, Mutter und Freundin. Ihr regelmäßiger intellektueller Austausch mit Schriftstellerkolleginnen und -kollegen wie Ingeborg Drewitz, Hilde Domin, Hermann Kesten, Walter Mehring, Kurt Pinthus und vielen anderen liefert kostbare literaturgeschichtliche Dokumente.

Feiner Geist: Die Lyrikerin Ann Cotten weilt gerade in Japan. Das hat ihre Lektüre der Gesammelten Werke von Mascha Kaléko beeinflusst.
Von Ann Cotten
Eine Gesamtausgabe Werke und Briefe ist immer ein schreckliches Spektakel. Soweit ich selbst über meine entsprechenden Begegnungen entscheiden kann, scheue ich diese auf einen Schlag so umfangreichen Begegnungen auf Papier: Zuerst ist es zu viel, bestenfalls gerät man in unverhältnismäßige Begeisterung über einen Autor und verzerrt dadurch seine Bedeutung; kurze Zeit später gehen einem der ganze Kleinkram, die ranzigen Seiten jedes Menschenlebens, die naiven und störrischen Einbildungen dieses Individuums auf den Keks. Man versteht nun, warum sich viele von ihm abwandten bis hin zur faktischen Geste der Entwertung und Unterbewertung. Die Figur ist dann allzu schnell gestorben, glanzlos, für mich in näherer Zeit ohne Zukunft. Deshalb also ist es ein Prozess, den ich lieber vermeide - ich stürze mich lieber über eine einzelne Erzählung oder Begebenheit in Begeisterung und übe absichtliche Ignoranz, um nicht zum gefürchteten Ereignis zu gelangen, der gefühlten Gesamteinschätzung einer Person.
Nun erreicht mich die Gesamtausgabe von Mascha Kaléko in einem freiwilligen zweimonatigen Exil in Japan, und mein Eindruck vom Werk steht unter dem Einfluss seltsamer, nichtssagender Koinzidenzen. Es gibt massive altmodische Gepflogenheiten der Japaner, insbesondere abseits der Hauptstadt, die sich wie ein Sprung in die zwanziger Jahre anfühlen: das viele Personal zum Beispiel, mit dem man umgeht wie damals. Dann die Fluten von Angestellten, die Glitzerspektakel der Kaufhäuser, meist mit feinerem Geschmack ausgestattet als bei uns, so dass man nicht anders kann, als mit aufrichtigen Kinderaugen zu bewundern, was man sieht, wenn man nachts durch die kalte teure Stadt flaniert. Schlechte Heizungen, grüne Plüschbänke in auberginefarbenen Vorortbahnen, große Mengen geistreicher Hausfrauen und abenteuerlich sportliche Ausreißer, die irgendwie ihren Weg gehen, die müden, brutalen und witzigen Leute, die Frische, die Extreme, das Ausmaß manueller Arbeit und Sorge, kurz: eine gewisse Härte des städtischen Umfelds.
In diese Welt passen die frühen Gedichte Kalékos ganz erstaunlich gut. Es fehlt hier jede revolutionäre Aussicht; die Realistin Kaléko würde die Japaner wohl für verblendet halten. In ihren Texten ist man tapfer und kompetent und motzt kräftig. Eine Angestellte weiß um die erfrischende Wirkung witziger Reime, will Resultate, ja konkrete, fassbare Produkte von Gedichten: Pointen.
Manchmal geht mir das sehr gegen den Strich. In der Leere nach und zwischen den Gedichten meine ich den rituellen Stoßseufzer zu hören, der bedeutet "So, jenug jequasselt, zurück zur Arbeit" - resigniert und ganz eingebunden in den beklagten Zusammenhang. Kaléko verwendet ihren Geist, um sich in diesen brutalen Zusammenhängen ein wenig zu Hause zu fühlen. Das ist eine Arbeit, die sie von jenen Dichtern unterscheidet, die sich als Sprachrohr des Anderen, als radikale Gegner des Lebens oder der Unterdrückung verstehen. Auch wenn sie sehr schlechte radikale Gedichte schreiben, blicken sie auf lebenstüchtig gesinnte Kollegen meist mit Verachtung herab.
Dagegen wirkt Kalékos Stand wie mitten im Leben, wie eine Provokation, ohne das zum Klischee zu machen. Man kann ihr für diese Tüchtigkeit nicht genug Respekt zollen. Und doch könnte ich manchmal auf sie eindreschen und fragen, ob sie nicht auch das Große Schwarze Zeug kenne, das imstande ist, so einen Vierzeiler zwischen den Kiefern zu zermalmen wie einen Käfer; ob sie denn nie zum Himmel hinaufschaue, und ob, wenn sie zum Himmel hinaufschaue, denn ihre geistreich trappelnden Füße nicht aus dem Takt kommen? Nun ja, das kenne ich, das ist ein Effekt von Pointen, die eintreffen wie Meereswellen: Man wendet sich nach etwa zwanzig Stück etwas anderem zu.
Wirklich hauen könnte ich sie wegen ihrer Werbetexte - sich für solche Nichtse so ins Zeug zu legen! Aber sie war jung und brauchte Geld, und ihr Stil ist virtuose Brillanz auf Abruf - es fühlt sich gut an, gut zu arbeiten. Außerdem ist eine Gesamtausgabe nicht dazu da, sich zu entscheiden, ob man ihre Autorin hauen muss oder nicht. Sie zeigt mir ein Weltpanorama. Wer nicht in alten Zeitungen wühlt, freut sich vielleicht wie ich auf die Gelegenheit, Plattenkritiken aus den Zwanzigern zu lesen, quicklebendige Foxtrottkritiken, in die breites musikalisches Wissen einfließt, ein scharfes Ohr Referenzen heraushört und Melodien treffend charakterisiert.
Kalékos musikalische Schriften brauchen - ignoriert man den Anteil aus Thekenrüschen - einen Vergleich mit jenen großen Herren, die im Ruf stehen, allein auf weiter Flur über Musik schreiben zu können, nicht zu scheuen: Adorno und Thomas Mann etwa, denen man ja auch ihre sphärendeformierten Rüschen (Sakkos) nachsieht. Zu deren grammatischen Gewändern passt ein Spruch aus Kalékos letztem Aphorismenband, 1973 in der Eremiten-Presse erschienen: "Mit manchen Leuten lohnt es sich zu leben. / Mit andern wieder macht es keinen Spaß. / Aus lauter Angst sich etwas zu vergeben, / vergibt sich diese Sorte immer was."
Wobei ich schwer zu sagen finde, was "sich etwas vergeben" ganz genau bedeutet - es ist eines dieser verfluchten deutschen Wörter, die sich aus allgemeinen Teilen zusammenstellen und ihren Gehalt bloß aus dem beziehen, was sich um sie ansammelt, und das ist regional unterschiedlich. Vielleicht war der Ausdruck Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts geläufiger; heute klingt er, meine ich, nur in festgefügten Wendungen richtig. Wie das beim Erscheinen des Gedichts 1973 war, als Kaléko selbst schon seit fünfunddreißig Jahren nicht mehr im deutschen Sprachraum lebte, kann ich nicht sagen. Jedenfalls meine ich, bei diesen zwei Zeilen eine delikate Qualität der Wackligkeit zu hören - wie bei der Stimme einer alten Frau, die brüchig wird, wenn sie singt: Der Ausdruck ist so lange nur in einem engen Kanon von Ausdrücken verwendet worden, dass er unter der Last einer Pointe ächzt und knackt.
Nun gibt mir die japanische Erfahrung die Möglichkeit, das nicht mit Nachsicht als Fehler zu beurteilen, sondern feinschmeckerisch als Textur, die nur zu erreichen ist, wenn eine erlesen geistreiche Frau jahrzehntelang im Exil lebt. Trotz der Gefahr, wie ein Weinkenner zu schwärmen, tue ich es: Diese Zeilen klingen wie Talking Heads, Magnetic Fields, Erich Kästner und Roxy Music, gemischt im Gefäß der Stimme von Akihiro Miwa, der Yoritake no Uta interpretiert, gereift wie ein tausendjähriges Ei. Selbstbezüglichkeit als Sprung: Auf diese Pointe wird, trotz des abgelaufenen Ausdrucks und des unreinen Reims, nicht verzichtet. Und deswegen, weil Kaléko demonstriert, worüber sie spricht - aber nur wenig, als kokette Reizonomatopöie -, ist sie genial.
Als ungeduldiger Mensch habe ich eine Weile gebraucht, bis ich die Chronik im Kommentarband fand. Dahinter folgt noch ein nettes Vorwort, dessen Plazierung ich sehr fein gewählt finde. Überhaupt ist der Kommentarband eine Schatztruhe: Zwischen trockenen Publikationsangaben finden sich plötzlich ein zärtliches Gedenken an Franz Hessel im Radio, ein Interview oder eine Erklärung Kalékos, warum sie ein bestimmtes Gedicht nicht allein veröffentlicht sehen will. Ob man flüchtige, unentschiedene, kommentarbandscheue Leser vielleicht mehr an die logische Gliederung ihres Interesses erinnern würde, wenn die kurzen Einführungen in den Textbänden statt im Kommentarband stünden? Die Frage wurde möglicherweise aufgrund des Umfangs der Bände entschieden.
Es gibt ein rührendes Hörspiel zu lesen, mit exquisiten Besetzungsangaben fürs Orchester. Jüdische Identität zwischen Österreich-Ungarn, Berlin, Amerika und Israel wird als Realität erspürbar, womit ich angesichts der gebotenen Kürze hier nicht anfangen will. Ich schließe mit meinem heutigen Lieblingsstück von Mascha Kaléko: "Die immer auf die Füße / fallen / mir auf die Nerven."
Ann Cotten, geboren 1982 in den Vereinigten Staaten, schreibt ihre Lyrik auf Deutsch. Zuletzt erschien 2010 "Florida-Räume".
Mascha Kaléko: "Sämtliche Werke und Briefe".
Hrsg. von Jutta Rosenkranz. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2012. 4 Bd. im Schuber, zusammen 4068 S., geb., 198,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Eigentlich passt eine gravitätische Gesamtausgabe ja gar nicht zu Mascha Kaleko, dieser Meisterin der leichten Dichtkunst, überlegt Sabine Rohlf, aber da Kaleko sie verdient hat, und die Edition ausgesprochen unpompös daherkommt, nimmt die Rezensentin sie mit großer Freude auf. Sie zeigt sich als große Bewunderin der Dichterin, die so wunderbar salopp und berlinerisch dichten konnte, als käme sie aus Neukölln (dabei war sie in Galizien geboren): "... Wer denkt daran, an später noch zu denken?/ Man spricht konkret und wird nur selten rot." Rohlfs verortet die Dichterin mit ihren modernen, sachlichen Versen zwischen Heine, Tucholsky und Claire Waldoff, weist aber auch auf Kalekos dunklere Gedichte hin, die während ihres Exils ab 1938 in New York entstanden. Dass auch die beklemmenden Briefe, die Kaleko nach 1945 an ihren Mann von einem Deutschland-Besuch schrieb, in der Edition enthalten sind, weiß die Rezensentin sehr zu schätzen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Wenn man über Mascha Kaléko schreibt, gerät man leicht ins Schwärmen (...). Tamara Dotterweich Nürnberger Zeitung 20130614
»Wer je dem ironisch-zärtlichen, sehnsüchtigen Ton ihrer Großstadtlyrik begegnet ist, der ist ihm sogleich verfallen.Mascha Kaléko (1907-1975) steht mit Brecht, Kästner und Tucholsky für den Sound der neuen deutschen Sachlichkeit.« Andreas Breitenstein, Neue Zürcher Zeitung 29.09.2012