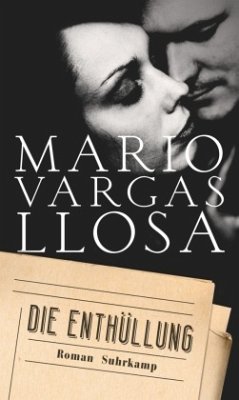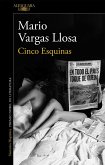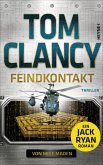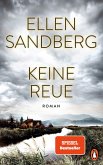Enrique ist glücklich verheiratet, beruflich erfolgreich und hat ein Riesenproblem: Er wird erpresst. Von Garro, dem Besitzer eines Boulevardblatts, der belastende Fotos hat und Enrique zwingen will, in die strauchelnde Zeitschrift zu investieren. Enrique sucht Rat bei Luciano, seinem alten Weggefährten und Anwalt, verliert jedoch im entscheidenden Moment die Nerven und bietet dem Erpresser offen die Stirn. Der bringt darauf die Fotos und wird kurze Zeit später tot aufgefunden, brutal ermordet. Enrique, geschäftlich wie moralisch ruiniert, glaubt, das sei das Ende. Doch es ist erst der Anfang. Denn während die Polizei ihn der Bluttat verdächtigt und er in undurchsichtige Machenschaften gerät, die aus den allerhöchsten Regierungskreise gesteuert scheinen, kommen sich seine und Lucianos Frau mehr als nur freundschaftlich nahe...»Die Enthüllung« ist eine brisante Spannungsgeschichte, ein erotisches Kammerspiel und ein zeitpolitischer Schlüsselroman - voller Überraschungen, Wendungen, Abgründe und Verheißungen. Mario Vargas Llosa hat ein so kunstreiches wie lebensechtes Panorama der menschlichen Verhältnisse geschaffen, ein Werk von staunenswerter Tiefenschärfe und bleibender Gültigkeit.
In seinem neuen Roman "Die Enthüllung" beschreibt Mario Vargas Llosa die 1990er-Jahre in Peru zur Zeit von Präsident Alberto Fujimori. Damals, sagte Vargas Llosa bei der Vorstellung des Buches im Frühjahr 2016 in Madrid, haben Terrorismus, eine verkommene Moral und Gewalt weite Teile des gesellschaftlichen Lebens beherrscht. Regimegegner wurden getötet oder durch Diffamierung in den Medien zum Schweigen gebracht. Der Präsident und auch andere Personen werden in dem Roman namentlich genannt, obwohl es sich um eine fiktive Geschichte mit fiktiven Figuren handelt. Vargas Llosa, der sich in den 1980er-Jahren der Politik zugewandt hatte, bewarb sich im Jahr 1990 als Kandidat der oppositionellen Frente Democrático (FREDEMO) um das peruanische Präsidentenamt, galt lange Zeit sogar als Favorit, unterlag aber letztendlich in einer Stichwahl Alberto Fujimori.
Auch wenn sich Mario Vargas Llosa nach dieser Niederlage aus der aktiven Politik zurückgezogen hat, ist der Schriftsteller, Politiker und Journalist, geboren 1936 in Areqipa/Peru, zeit seines Lebens als politischer Autor aufgetreten. Wie der neue Roman "Die Enthüllung" spielen dabei viele seiner Romane und Erzählungen in Peru und thematisieren die gesellschaftliche Entwicklung des Landes. Dabei ist Vargas Llosa weit über dessen Grenzen hinaus bekannt.
Heute gilt Mario Vargas Llosa als einer der einflussreichsten und meist ausgezeichneten Romanciers und Essayisten Lateinamerikas. So erhielt er im Jahr 1996 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und im Jahr 2010 den Nobelpreis für Literatur "für seine Kartographie der Machtstrukturen und scharfkantigen Bilder individuellen Widerstands, des Aufruhrs und der Niederlage", wie es in der Begründung des Nobelpreiskomitees hieß.
Bereits während des Studiums der Geistes- und Rechtswissenschaften in Lima und Madrid veröffentlichte Vargas Llosa erste Erzählungen; einem breiten Publikum bekannt wurde er im Jahr 1963 mit seinem ersten Roman "Die Stadt und die Hunde", in dem er autobiografische Erfahrungen aus der Kadettenanstalt verarbeitete und durch Gewalt geprägte Gesellschaftsstrukturen analysierte. Das Buch wurde damals in Lima öffentlich verbrannt.
Mario Vargas Llosas Schaffen ist breit gefächert und umfasst bis heute Romane, Kriminalgeschichten, politische Thriller, Komödien, Theaterstücke, Essays, politische und literaturwissenschaftliche Schriften. Zu seinen wichtigsten Werken zählen "Das grüne Haus" (1966), das fünf Handlungsstränge zu einem Ganzen vereint, sowie "Das Fest des Ziegenbocks" (2000), "Tante Julia und der Schreibkünstler" (1977) und "Das böse Mädchen" (2006). Die allgegenwärtige Gewaltbereitschaft und die gesellschaftliche Verrohung Perus waren schon Thema seines berühmten Kriminalromans "Tod in den Anden" aus dem Jahr 1993, in dem zwei Polizisten das rätselhafte Verschwinden von Menschen in einer Siedlung aufzudecken versuchen.
Auch wenn sich Mario Vargas Llosa nach dieser Niederlage aus der aktiven Politik zurückgezogen hat, ist der Schriftsteller, Politiker und Journalist, geboren 1936 in Areqipa/Peru, zeit seines Lebens als politischer Autor aufgetreten. Wie der neue Roman "Die Enthüllung" spielen dabei viele seiner Romane und Erzählungen in Peru und thematisieren die gesellschaftliche Entwicklung des Landes. Dabei ist Vargas Llosa weit über dessen Grenzen hinaus bekannt.
Heute gilt Mario Vargas Llosa als einer der einflussreichsten und meist ausgezeichneten Romanciers und Essayisten Lateinamerikas. So erhielt er im Jahr 1996 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und im Jahr 2010 den Nobelpreis für Literatur "für seine Kartographie der Machtstrukturen und scharfkantigen Bilder individuellen Widerstands, des Aufruhrs und der Niederlage", wie es in der Begründung des Nobelpreiskomitees hieß.
Bereits während des Studiums der Geistes- und Rechtswissenschaften in Lima und Madrid veröffentlichte Vargas Llosa erste Erzählungen; einem breiten Publikum bekannt wurde er im Jahr 1963 mit seinem ersten Roman "Die Stadt und die Hunde", in dem er autobiografische Erfahrungen aus der Kadettenanstalt verarbeitete und durch Gewalt geprägte Gesellschaftsstrukturen analysierte. Das Buch wurde damals in Lima öffentlich verbrannt.
Mario Vargas Llosas Schaffen ist breit gefächert und umfasst bis heute Romane, Kriminalgeschichten, politische Thriller, Komödien, Theaterstücke, Essays, politische und literaturwissenschaftliche Schriften. Zu seinen wichtigsten Werken zählen "Das grüne Haus" (1966), das fünf Handlungsstränge zu einem Ganzen vereint, sowie "Das Fest des Ziegenbocks" (2000), "Tante Julia und der Schreibkünstler" (1977) und "Das böse Mädchen" (2006). Die allgegenwärtige Gewaltbereitschaft und die gesellschaftliche Verrohung Perus waren schon Thema seines berühmten Kriminalromans "Tod in den Anden" aus dem Jahr 1993, in dem zwei Polizisten das rätselhafte Verschwinden von Menschen in einer Siedlung aufzudecken versuchen.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Bei Vargas Llosa scheint die Entwicklung irgendwie anders herum zu verlaufen als normalerweise, wundert sich Rezensent Sebastian Schoepp. Während seine ersten Romane wie "Die Stadt der Hunde" oder "Das grüne Haus" jene Weisheit und Komplexität in jeder Hinsicht aufweisen, die man eigentlich von erfahrenen Schriftstellern erwarten würde, zeichnet sich sein Spätwerk, insbesondere der neuste Roman "Die Enthüllung", durch glatte, klischeehafte Charaktere, fantasielose Schmuddel-Szenen, flache Handlungsstrukturen und plumpe Beschreibungen aus, die man eher einem (weniger talentierten) Schreib-Anfänger zuordnen würde, lesen wir. Lediglich eine Randfigur namens La Retaquita beweist, dass es mit Llosas Erzählkunst vielleicht noch nicht ganz vorbei ist, ansonsten hat der Roman wenig zu bieten, so der erbarmungslose Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Der neue Roman des Nobelpreisträgers Mario Vargas Llosa "Die Enthüllung" versucht sich erfolglos an einem peruanischen Sittenstück.
Es ist legitim, dass Schriftsteller eigene Erlebnisse und Erfahrungen zur Grundlage ihrer Literatur machen, manchmal scheint es sogar zwingend. Manchmal geht es aber auch grandios schief, so wie im neuen Roman von Mario Vargas Llosa. In "Die Enthüllung" arbeitet sich der achtzigjährige Nobelpreisträger des Jahres 2010 gleich an zwei autobiographischen Blessuren ab: Die eine stammt von der Boulevardpresse, die dem Schriftsteller übel mitspielte, als er sich nach fast einem halben Jahrhundert unlängst von seiner Ehefrau trennte, um ein ehemaliges Model zu heiraten. Das andere Trauma ist nicht privater, sondern politischer Natur und führt zurück in die jüngere Vergangenheit seines Heimatlandes Peru.
Im Jahr 1990 hatte sich Mario Vargas Llosa, der inzwischen in Spanien lebt, um das Amt des peruanischen Staatspräsidenten beworben, die Wahl mündete in eine Stichwahl zwischen ihm und seinem Widersacher Alberto Fujimori. Dabei unterlag der Schriftsteller nicht nur, sondern musste auch in der Folgezeit mit ansehen, wie der zur Macht gelangte Konkurrent Peru Stück für Stück in eine korrupte Scheindemokratie verwandelte und dabei vor Massakern und dem Einsatz von Todesschwadronen nicht zurückschreckte. Im Jahr 2009 wurde Fujimori für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu fünfundzwanzig Jahren Gefängnis verurteilt und sitzt seither in Haft.
Mario Vargas Llosa hätte mithin reichlich Stoff gehabt für einen großen Roman, ein peruanisches Sittenstück, enthüllend im Sinne der Romantitels. Stattdessen bringt er in einer plotgetriebenen, von Dialogen durchsetzten Erzählung die beiden Sphären uninspiriert zusammen: den Boulevard, der noch jeden unbescholtenen Bürger zur Strecke bringen kann, und Fujimoris Schreckensregiment, das ein Land in Angststarre versetzt. Die Macht des Staates, so die These, baut auf die Macht öffentlicher Vernichtung: Wer dem Regime nicht passt, wird mit Hilfe gekaufter Schreiberlinge durch üble Nachrede, Denunziation und Falschaussagen bloßgestellt, Existenzen vernichtet.
Seine Geschichte siedelt Vargas Llosa in den neunziger Jahren in der Hauptstadt Lima an. Die Oberschicht befindet sich längst in der inneren Emigration, dem Terror und der Furcht entgeht man in diesen Kreisen mit Yoga-Übungen und Wochenendausflügen nach Miami. Gelangen Bekannte von Bekannten doch einmal in die Hände von Terroristen oder die Mühlen der Politik, wird allenfalls darüber spekuliert, welchen Therapeuten die Hinterbliebenen am besten aufsuchen sollten.
Zwei Paare sind das zynische Abbild dieser von Ignoranz und Arroganz geprägten Schicht. Auch sie haben sich allenfalls zuschulden kommen lassen, in ihrer Luxusblase vor sich hin zu leben, als sie durch Zufall in die Menagerie der öffentlichen Diffamierung geraten. Enrique, ein erfolgreicher und eigentlich glücklich verheirateter Unternehmer, wird mit Fotos erpresst, die ihn in ungünstiger Pose mit Prostituierten zeigen. Als er sich weigert, auf die Forderungen des Klatschreporters Garro einzugehen, veröffentlicht der umgehend sein Material. Enrique, von der öffentlichen Schmach gebeutelt, sucht Rat bei seinem Freund, dem Anwalt Luciano.
Während die beiden Männer alles daransetzen, um die Folgen der Pressekampagne wieder in den Griff zu bekommen, treibt ihre beiden Ehefrauen, die eine blond, die andere brünett, die Sorge um eine ganz andere Enthüllung um: Denn sie haben unlängst Gefallen aneinander gefunden und sich in eine liaison dangereuse begeben, die sie in ihren Kreisen lieber geheim gehalten sehen wollen. Diese Buffoszenen einer peruanischen Dekadenz kontrastiert Mario Vargas Llosa mit der Düsternis der politischen Hintergründe, auf deren Folie der Roman in einer zweiten Ebene operiert. Vollstrecker der Macht ist nicht etwa der Mann an der Spitze, sondern sein Geheimdienstchef, der, ebenfalls einem realen Vorbild nachempfunden, von allen nur "Doktor" genannt wird.
Der Zynismus einer rücksichtslosen Schicht wie einer gewissenlosen Presse, um den es Vargas Llosa in seinem Roman neben der Bloßstellung einer korrupten Autokratie zu tun ist, gerät dabei dem Roman selbst zum Verhängnis - weil seinen Protagonisten auf diese Weise jede Vielschichtigkeit und Ambivalenz verwehrt bleibt. Womöglich hat Vargas Llosa die Figuren für seine Demonstrationszwecke sogar bewusst stereotyp angelegt. Sie wurden dazu erdacht, bestimmte Positionen einzunehmen, bestimmte Haltungen zu transportieren. Von der Last dieser Konstruktion aber, die einhergeht mit schlichter Psychologie, erholt sich der Roman nicht mehr. Sätze, die hier fallen, klingen dann so: "Der Artikel ist fertig, Chef, die Einäugige ist im Arsch." Vor allem sprachlich enttäuscht das Buch. Es enthält Phrasen und Redundanzen, der Doktor wird gleich mehrfach als "berüchtigt" bezeichnet, als fehlten dem Autor die Worte. Stets klärt die direkte Rede, was es zu klären gibt: "Dieser Mensch bekommt den Hals nicht voll, er ist unfassbar geldgierig. Es gibt Anzeichen dafür, dass er zahlreiche kleinere Unternehmer erpressen lässt." So weit, so klar.
Nicht die Ohnmacht des Schreckens wird da in Gestalt des Doktors greifbar, sondern eher eine Karikatur des Bösen. Aber auch die Journalisten in seinen Diensten werden zur Parodie, wenn der eine als hässliches Männlein mit Pomade im Haar und hochhackigen Schuhen erscheint, statt ihn beispielsweise mit jener gefährlichen Intelligenz auszustatten, die zu den Abscheulichkeiten seines Gewerbes gut passen würde. Seine Kollegin wiederum ist die verwachsene Zwergin aus den Slums von Lima, deren Hass auf die Privilegierten grenzenlos ist. Das Grauen packt einen beim Lesen viel eher an anderen Stellen, etwa während des Liebesaktes der beiden Ehefrauen gleich zu Beginn des Romans - was da über Frauenkörper und Flüssigkeiten ohne jede Sinnlichkeit zur Sprache kommt, lässt sich nicht anders denn als gruselige Männerphantasie lesen. Enthüllend ist in diesem Werk, wie deutlich auch ein Autor, der einen Roman von höchstem Rang wie "Lob der Stiefmutter" geschrieben hat, so unter seinen Möglichkeiten bleiben kann.
SANDRA KEGEL
Mario Vargas Llosa: "Die Enthüllung". Roman.
Aus dem Spanischen von Thomas Brovot. Suhrkamp Verlag, Berlin 2016. 301 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Wie nur wenige schafft es Vargas Llosa, ein Höchstmaß an emotionaler Intensität in einen Roman zu packen.« Neue Zürcher Zeitung
» ... spannend von der ersten bis zur letzten Seite.« Annette Wirthlin Schweizer Familie