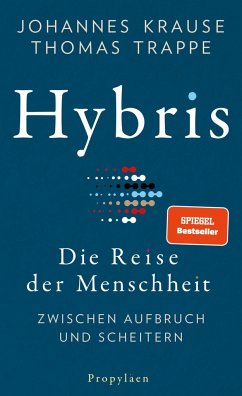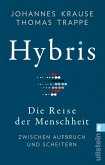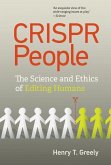Die Menschheit am Scheideweg: Hat unsere Spezies eine Zukunft?
In atemberaubendem Tempo haben die Menschen den Planeten ihren Bedürfnissen unterworfen. Im 21. Jahrhundert stehen sie vor den Scherben ihres Tuns: Die natürlichen Ressourcen erschöpft, die Klimaerwärmung eine tödliche Bedrohung, globale Pandemien eine akute Gefahr. Werden wir auch diese Krise meistern? Die Bestsellerautoren Johannes Krause und Thomas Trappe zeigen, was wir aus der Vergangenheit für unser Überleben lernen können - und welche Gefahren in der zügellosen Kraft des Menschen liegen.
In atemberaubendem Tempo haben die Menschen den Planeten ihren Bedürfnissen unterworfen. Im 21. Jahrhundert stehen sie vor den Scherben ihres Tuns: Die natürlichen Ressourcen erschöpft, die Klimaerwärmung eine tödliche Bedrohung, globale Pandemien eine akute Gefahr. Werden wir auch diese Krise meistern? Die Bestsellerautoren Johannes Krause und Thomas Trappe zeigen, was wir aus der Vergangenheit für unser Überleben lernen können - und welche Gefahren in der zügellosen Kraft des Menschen liegen.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensentin Manuela Lenzen verfolgt gerne die Reise der Menschheit, die der Paläogenetiker Johannes Krause und der Journalist Thomas Trappe in ihrem Buch nachzeichnen, auch wenn sie den Begriff der Reise hier nicht ganz passend findet. Denn der homo sapiens habe zwar nach und nach den gesamten Globus besiedelt, aber die Ausbreitung sei sehr langsam von statten gegangen und die meisten Menschen seien erst einmal an Ort und Stelle geblieben. Zudem lernt die Kritikerin, die auch Ethnologie studiert hat, Wissenswertes über das Verhältnis zum Neandertaler, die eher unsympathische Unersättlichkeit und die genetische Nachverfolgbarkeit der Spezies - vor allem über die "spannende" paläogenetische Technik, mit der Zellen aus Knochen untersucht und sogar weitergezüchtet werden können, hätte Lenzen gern noch viel mehr erfahren.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Rückblick mithilfe der Archäogenetik: Johannes Krause und Thomas Trappe zeichnen nach, wie Homo die Erde eroberte
Wir hatten Glück: Hätte der Mensch in Südostasien begonnen, seine wichtigsten Beutetiere zu Haustieren zu domestizieren, könnten die Ställe heute voller riesiger Schlacht- und Milchratten sein. Denn bibergroße Ratten waren zum Beispiel für den nur 1,20 Meter großen Homo floresiensis, "Hobbit" genannt, der vor etwa sechzigtausend Jahren auf der indonesischen Insel Flores lebte, Grundnahrungsmittel. Die großen Ratten gibt es dort bis heute, der "Hobbit" allerdings ist verschwunden, und die Haustierhaltung begann weiter nördlich mit den Vorläufern von Ziege, Schaf, Kuh und Schwein.
Aus der Schule nimmt man mit, dass "der Mensch" in Afrika entstand und von dort aus jedes brauchbare Fleckchen Erde besiedelte. Dass dies die extrem vereinfachte Fassung eines komplexen Geschehens ist, liegt auf der Hand. Wie komplex es tatsächlich war, kann man nun in der beeindruckenden Rückschau des Paläogenetikers Johannes Krause und des Journalisten Thomas Trappe nachlesen. Nach ihrem Buch "Die Reise unserer Gene" haben die Autoren die Perspektive jetzt von Europa auf die ganze Welt ausgedehnt und die "Reise der Menschheit" nachgezeichnet, von den frühesten Menschenformen bis zur weltweiten Vorherrschaft der Europäer im sechzehnten Jahrhundert und dem "Homo hybris" der Gegenwart.
Dabei wird zuerst einmal deutlich, dass schon die Bezeichnung "Reise" sehr metaphorisch zu lesen ist. Zwar attestieren die Autoren den frühen Menschen eine "unermessliche Wanderlust", und es gab immer wieder eine mutige Vorhut, die sich aufmachte, um neues Land zu besiedeln, doch die meisten blieben wohl im Wesentlichen, wo sie waren, und verschoben ihre Jagdgründe oder später ihre Felder nur Stück für Stück. Zudem handelte es sich nicht um eine kontinuierliche Reise, sondern um immer wieder neue Wanderungsbewegungen, die mal erfolgreich waren und mal nicht. Erst im Zeitraffer des Rückblicks schnurren die etwa 2,5 Millionen Jahre seit der Entstehung der Gattung Homo auf eine Reise zusammen, die von Afrika über die Arabische Halbinsel erst nach Europa, Asien und Australien führte, später mit einem kleinen Umweg durch das Gebiet des heutigen Kanada bis nach Feuerland, wo unsere Vorfahren vor etwa vierzehntausend Jahren ankamen.
Und es war auch nicht einfach "der Mensch", der sich ausbreitete, nur haben sich von den "unzähligen" Vormenschen nur spärliche Spuren erhalten, so die Autoren. In Eurasien waren es vor allem Neandertaler und Denisovaner, mit denen der moderne Mensch jahrtausendelang Seite an Seite lebte. Nicht immer friedlich, hatten sich doch etwa die Neandertaler längst in den Steppen Mitteleuropas etabliert, als Homo sapiens auftauchte und ihnen ihren Lebensraum streitig machte. Aber immerhin kamen sie sich so nahe, dass bis heute die Menschen außerhalb Afrikas zwei Prozent "Neandertalergene" tragen.
Die Autoren zeichnen nach, wie Klimaveränderungen die Ausbreitung der Menschen förderten, wie Naturkatastrophen sie ausbremsten und wie immer wieder Neuankömmlinge auf schon etablierte Gruppen trafen. So waren die Neandertaler durch ihre robuste Konstitution den modernen Menschen lange überlegen, konnten dann aber auf klimatische Veränderungen nicht flexibel genug reagieren. Als dann auch noch der Vulkan unter den Phlegräischen Feldern beim heutigen Neapel ausbrach und Aschewolken Europa verdunkelten, gelang es Letzteren wohl leichter, sich schnell neue Nahrungsquellen zu erschließen.
Die Prozesse der Besiedlungen, Begegnungen, Auseinandersetzungen und auch der Infektionskrankheiten, die mit den Menschen wanderten, lassen sich nicht einfach an gefundenen Schädeln und Knochen ablesen, wohl aber aus Analysen des genetischen Materials erschließen, das sich in diesen Knochen erhalten hat. Archäogenetik heißt diese recht neue Disziplin, in der aus winzigen genetischen Unterschieden im großen Schmelztiegel Menschheit abgeleitet wird, woher Individuen kamen. Im ersten Kapitel lernt der Leser, dass Forscher nicht nur das vorhandene Material analysieren, sondern auch versuchen, mithilfe gentechnischer Verfahren menschliche Zellen in einen früheren Zustand, etwa den eines Neandertalers, zurückzuversetzen. Solche Zellen kann man zu Zellklumpen anwachsen lassen und dann zum Beispiel ihren Stoffwechsel analysieren. Das ist spannend, klingt ein bisschen nach Frankenstein - natürlich werden keine Neandertaler im Reagenzglas gezüchtet -, spielt aber erstaunlicherweise im Rest des Buches keine Rolle mehr. Man hätte doch gern mehr darüber erfahren, wie diese Methode denn nun genutzt wird.
Bei allem Respekt vor der Hartnäckigkeit, mit der sich unsere Vorfahren trotz aller Rückschläge in der Welt ausbreiteten: So recht sympathisch ist den Autoren ihre eigene Spezies nicht. Denn während sich die anderen Menschenarten so gerade in der Natur behaupten konnten, kenne der Homo sapiens in seinem Erfolg kein Maß. Wo immer er auftauchte, verschwand die Großfauna, konstatieren Krause und Trappe: Alles, was viel Fleisch herumtrug, wurde verspeist, und was gefährlich oder lästig war, wurde getötet. Nur in Afrika gelang dies nicht, was die Autoren darauf zurückführen, dass die dortige Tierwelt mehr Zeit hatte, sich auf diese gefährlichen Zweibeiner einzustellen.
Unersättlichkeit und Erfindungsgabe ließen Homo sapiens erfolgreich den ganzen Globus besiedeln. Sie sind allerdings auch der Grund dafür, dass der Mensch sich heute selbst die größte Herausforderung ist, so die Autoren. "Homo hybris" nennen sie ihn im letzten Kapitel und meinen damit das Gegenteil der Genügsamkeit, die es braucht, um auf die Dauer mit einer endlichen Erde zurechtzukommen.
Diese Disposition "Hybris" zu nennen ist aber vielleicht eine ähnliche Vereinfachung wie jene, die Ausbreitung des Homo sapiens als "Reise" zu bezeichnen. Die längste Zeit dürfte den meisten Menschen Hybris fern gewesen sein. Genug zum Leben für sich und ihren Nachwuchs, viel mehr konnten sie kaum erwarten, und für viele gilt das bis heute. Sicher ist: Für uns gibt es so wenig wie für all die Menschenformen, die an Krankheiten, Naturkatastrophen oder an unseren Vorfahren scheiterten, eine Bestandsgarantie. Ob wir die anstehenden Herausforderungen meistern werden, ist offen. MANUELA LENZEN
Johannes Krause und Thomas Trappe: "Hybris". Die Reise der Menschheit zwischen Aufbruch und Scheitern.
Propyläen Verlag, Berlin 2021. 351 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Aus der Schule nimmt man mit, dass "der Mensch" in Afrika entstand und von dort aus jedes brauchbare Fleckchen Erde besiedelte. Das dies die extrem vereinfachte Fassung eines komplexen Geschehens ist, liegt auf der Hand. Wie komplex es tatsächlich war, kann man nun in der beeindruckenden Rückschau des Paläogenetikers Johannes Krause und des Journalisten Thomas Trappe nachlesen." Manuela Lenzen Frankfurter Allgemeine Zeitung 20220108