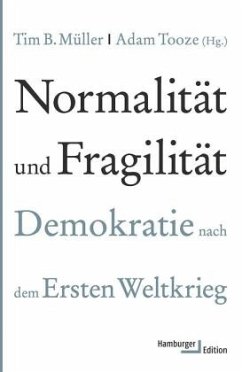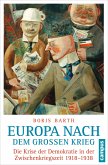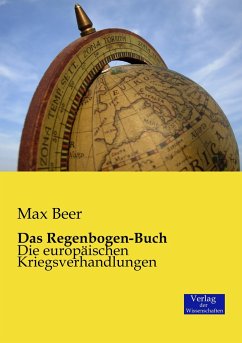Wenn heute die Fragilität der Demokratie wieder in den politischen Horizont rückt und von »gefährlichen Zeiten« für die Demokratie die Rede ist, lohnt sich ein Blick zurück auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.
In vielen europäischen Gesellschaften wurde die Demokratie damals gleichzeitig zur Regierungs- und Lebensform, machte den Schritt vom politisch Neuen zur Normalität. Aber diese Normalität war nicht ohne Fragilität zu denken.
Der Blick zurück eröffnet vor allem Einsichten in die erstaunliche Wandlungs- und Handlungsfähigkeit von Demokratien - sie überstanden auch extreme ökonomische und politische Krisen - aber auch in die Bedingungen für einen Zusammenbruch.
Historiker_innen aus zahlreichen europäischen Ländern und aus Amerika befassen sich mit Kernfragen der vergleichenden Demokratieforschung: mit der gesellschaftlichen Akzeptanz der Demokratie, der Vielfalt ihrer Ausdrucksformen in Politik und Alltagsleben oder der Ausbildung eines dauerhaften demokratischen Erwartungshorizonts. Sie gehen der Frage nach, wie die Demokratie selbstverständlich wurde und es auch in existenziellen Krisen blieb - und warum sie dennoch in einigen Fällen zerstört wurde.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
In vielen europäischen Gesellschaften wurde die Demokratie damals gleichzeitig zur Regierungs- und Lebensform, machte den Schritt vom politisch Neuen zur Normalität. Aber diese Normalität war nicht ohne Fragilität zu denken.
Der Blick zurück eröffnet vor allem Einsichten in die erstaunliche Wandlungs- und Handlungsfähigkeit von Demokratien - sie überstanden auch extreme ökonomische und politische Krisen - aber auch in die Bedingungen für einen Zusammenbruch.
Historiker_innen aus zahlreichen europäischen Ländern und aus Amerika befassen sich mit Kernfragen der vergleichenden Demokratieforschung: mit der gesellschaftlichen Akzeptanz der Demokratie, der Vielfalt ihrer Ausdrucksformen in Politik und Alltagsleben oder der Ausbildung eines dauerhaften demokratischen Erwartungshorizonts. Sie gehen der Frage nach, wie die Demokratie selbstverständlich wurde und es auch in existenziellen Krisen blieb - und warum sie dennoch in einigen Fällen zerstört wurde.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Ignaz Miller ist den Herausgebern Tim B. Müller und Adam Tooze durchaus dankbar, dass sie der Versuchung nicht widerstehen konnten, die Vielfalt, die der Titel ihres Sammelbandes eröffnet, auch abzubilden. Mit etwas Geduld, meint er, erhält der Leser dafür interessante Einblicke in die Entwicklung der Demokratie in Europa nach dem Ersten Weltkrieg, etwa am Beispiel Finnlands oder des republikanischen Spanien. Dass die meisten Essays im Band lesbar auch für Laien sind, hält Miller den Verfassern zugute. Laura Beers Text über "Frauen für Demokratie" wird ihm so zur inspirierenden Lektüre. Über die Suggestionskraft alternativer Regierungsformen hätte der Rezensent gerne mehr erfahren, ebenso über die Rolle der Industrie für die Entwicklung in Deutschland.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Die Entwicklung der Demokratie in Europa nach dem Ersten Weltkrieg
Ein Titel "Normalität und Fragilität" hat unbestreitbar Vorteile. Zwischen den Buchdeckeln findet so gut wie alles seinen natürlichen Platz. Nachteilig ist höchstens, dass die beiden Herausgeber dieser Versuchung nicht widerstehen konnten. Aber auch das kann sich zum Vorteil wenden. Wer lange genug durchhält, wird entschädigt mit lesenswerten Abrissen über den Aufbau der finnischen und tschechoslowakischen Demokratien, über das republikanische Spanien im Spiegel seiner illustrierten Presse oder etwa über die Crème der deutschen Finanzbürokratie der Weimarer Republik.
Dass diese Essays sogar noch lesbar geschrieben sind, sei nicht verschwiegen. Keineswegs alle Beiträge können für sich in Anspruch nehmen, sich auch solcher Leser zu erbarmen, die nicht dem innersten Fachmilieu angehören. Einfach machen es einige Autoren jedenfalls nicht, die Erinnerung an W. H. Audens Auftakt zu einer Rezension zu unterdrücken: "Falls Sie je Schwierigkeiten hatten einzuschlafen, hier das passende Buch für Sie."
Nach dem Ersten Weltkrieg und der großen Mobilisierung standen alle Gesellschaften vor der Aufgabe, ihre Partizipations-Basis zu erweitern. Die Zeiten der Wahlrechtbeschränkung waren selbst im reaktionären Preußen abgelaufen. Dass das Frauenstimmrecht international nur sehr zögerlich eingeführt wurde, war eine langfristige Folge der Französischen Revolution. Sie hatte die politischen Ansprüche der Frauen weitgehend ignoriert. Sehr zur Empörung von Mary Wollstonecraft. Was die 1797 verstorbene Mutter der Frankenstein-Erfinderin Mary Shelley vehement einforderte, bewilligte die Französische Republik erst 1945 (die Schweiz ließ sich auf föderaler Ebene sogar bis 1971 Zeit). Das Engagement endete aber keineswegs beim Stimmrecht, wie Laura Beer, eine in Washington D.C. ansässige Gelehrte, in ihrem inspirierenden Essay über "Frauen für Demokratie" ausführt. Vielfach vollzogen die Führungsfiguren eine Metamorphose vom inneren Leitbild Marias zu Athene. Was unter dem Eindruck des Weltkrieges als pazifistische Bewegung begann, mutierte angesichts der Gewaltregimes sachte zu einem wehrhaften Antifaschismus.
Die Gewalt und die Suggestionskraft alternativer Regierungsformen kommen etwas kurz in dem Band. Der Einfluss der Presse und der neue Typus des Massen- und Veranstaltungspolitikers auf die demokratische Willensbildung finden allenfalls indirekte Erwähnung. Nur: Die Attraktion eines Mussolini erschließt sich zwanglos vor dem Hintergrund ältlicher Provinzpolitiker im steifen Gehrock, die bereits beim Anblick eines Mikrofons stotterten. Der Duce war wenigstens noch ein sprach- und redegewandter Intellektueller mit einem Sinn für moderne Kunst und nachhaltigen Sätzen: "Die Italiener zu regieren ist nicht schwierig, sondern nutzlos." Aber wieso versprach sich das demokratische Deutschland sein Heil von einem abgebrochenen Kunstmaler wie Hitler und ließ die Ermordung des erfolgreichen Großindustriellen Walther Rathenau zu? Dazu würde man gerne mehr erfahren.
Die kollektiven Ansprüche der Wähler an das Führungspersonal wurden nur vom mangelnden Selbstrespekt unterboten. Die Weimarer Republik fand nie wirklich eine schlüssige Antwort auf die Gewaltbereitschaft und den Hass der Frustrierten, die aus den Schützengräben nichts mitgebracht hatten außer der Bereitschaft zu töten. Bei einem (ob seiner Mittäterschaft verurteilten) Ernst von Salomon reichte es immerhin noch zur literarischen Selbstentdeckung. Auf ihn wirkte bereits die Zuchthausstrafe resozialisierend. Aber auch darin war Salomon eine Ausnahme.
Dass sich die Weimarer Republik anstelle der in Versailles verordneten Friedenspolitik kollektiv einer Macht- und Gewaltpolitik mit anderen Mitteln verschrieb, statt mit der unseligen Tradition des Kaiserreichs mehr als nur formal zu brechen, sollte sich gründlich rächen. Was versprach sich eigentlich das Bürgertum - idealtypisch repräsentiert von Köpfen wie dem Historiker Percy Ernst Schramm - von der unbedingten Wiederaufrüstung? Noch dazu, wo das Land schon größte Probleme hatte, seine bereits überdehnten Haushalte zu finanzieren? Friedrich von Payer, der letzte Vizekanzler des Kaiserreichs, hatte in seinen Memoiren darauf hingewiesen, dass der Reichstag als solcher neu in seinem Geschäft war und vieles habe lernen müssen. Womöglich kam die Weimarer Republik etwas zu früh für das bislang mehrheitlich über das Drei-Klassen-Wahlrecht gegängelte Untertanenland. Wie sonst wäre es möglich gewesen, noch 1925 eine Mehrheit für den Kriegsverlierer Paul von Hindenburg zu finden?
In einer reifen Demokratie - sagen wir in England - hätte so etwas außerhalb aller Vorstellungen gelegen. Eine freie Presse hätte den intriganten Generalfeldmarschall längstens als Loser enthüllt und dafür gesorgt gehabt, dass er aus der unverdienten Pension nie zurückgekommen wäre. Diesen spezifischen Defiziten nachzugehen und zu zeigen, welche Machtmechanismen eine korrekte Wahrnehmung verhindert respektive eine verzerrte Wahrnehmung ermöglicht haben, bleibt eine der wichtigen Aufgaben der Demokratie-Forschung, die weiterhin der erkenntnisfördernden Bearbeitung harren.
Nur am Rande und sehr indirekt gestreift wird die Bedeutung der Industrie für Deutschland. Philipp Nielsen geht in seinem Essay kurz darauf ein. Die Industrie drängte die verbohrten Deutschnationalen dazu, den Dawes-Plan anzunehmen. Sie erwies (und erweist) sich in Deutschland immer wieder als das eigentliche Machtzentrum. In Frankreich und in Großbritannien ist das Parlament das Zentrum der Macht (in der Schweiz ist es effektiv das Volk). Der überstarke Einfluss der Industrie kam dem Land häufig, aber nicht immer zugute. Dank der Industrie wahrt es seine wirtschaftliche Potenz. Dies sind nicht die schlechtesten Voraussetzungen für eine gedeihliche Demokratie. Man würde gerne mehr darüber erfahren. Hoffen wir, wie im Kino, auf "Demokratie II".
IGNAZ MILLER
Tim B. Müller/Adam Tooze (Herausgeber): Normalität und Fragilität. Demokratie nach dem Ersten Weltkrieg. Hamburger Edition, Hamburg 2015. 518 S., 35,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main