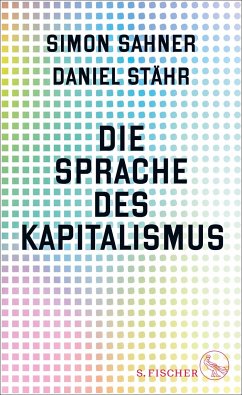Wir müssen anders über Geld und Wirtschaft sprechen, wenn wir zu einem gerechteren Miteinander gelangen wollen: Der Literaturwissenschaftler Simon Sahner und der Ökonom Daniel Stähr gehen der Sprache des Kapitalismus auf den Grund.
Preise steigen nicht von alleine. Es gibt jemanden, der sie erhöht. Das zu verstehen, ist entscheidend. Sprache schafft Realitäten und festigt Machtstrukturen. Das gilt nicht nur für Diskriminierungsformen wie Rassismus oder Sexismus, sondern auch für unser Wirtschaftssystem, den Kapitalismus. Wenn Ökonomen, Unternehmen und die Politik Finanzkrisen als Tsunamis und Stürme bezeichnen, suggerieren sie ihre und unsere Machtlosigkeit. Es gibt aber Akteure im kapitalistischen System und es gibt Möglichkeiten, auf andere Weise über Geld und Wirtschaft zu sprechen und davon zu erzählen.
Anhand von zahlreichen Metaphern und Sprachbildern, einschlägigen Beispielen aus Film und Literatur sowie den Selbsterzählungen von Unternehmern wie Steve Jobs oder Elon Musk analysieren Simon Sahner und Daniel Stähr die Sprache des Kapitalismus und seine Geschichten. Was steckt hinter Begriffen wie »Rettungsschirm«, »Gratismentalität« und »too big to fail«? Wieso erfreut sich die Figur des »Unternehmergenies« so großer Beliebtheit? Und: Wie können wir neue Narrative schaffen, um uns aus der scheinbaren kapitalistischen Alternativlosigkeit zu befreien und Veränderungsmöglichkeiten aufzuzeigen?
Preise steigen nicht von alleine. Es gibt jemanden, der sie erhöht. Das zu verstehen, ist entscheidend. Sprache schafft Realitäten und festigt Machtstrukturen. Das gilt nicht nur für Diskriminierungsformen wie Rassismus oder Sexismus, sondern auch für unser Wirtschaftssystem, den Kapitalismus. Wenn Ökonomen, Unternehmen und die Politik Finanzkrisen als Tsunamis und Stürme bezeichnen, suggerieren sie ihre und unsere Machtlosigkeit. Es gibt aber Akteure im kapitalistischen System und es gibt Möglichkeiten, auf andere Weise über Geld und Wirtschaft zu sprechen und davon zu erzählen.
Anhand von zahlreichen Metaphern und Sprachbildern, einschlägigen Beispielen aus Film und Literatur sowie den Selbsterzählungen von Unternehmern wie Steve Jobs oder Elon Musk analysieren Simon Sahner und Daniel Stähr die Sprache des Kapitalismus und seine Geschichten. Was steckt hinter Begriffen wie »Rettungsschirm«, »Gratismentalität« und »too big to fail«? Wieso erfreut sich die Figur des »Unternehmergenies« so großer Beliebtheit? Und: Wie können wir neue Narrative schaffen, um uns aus der scheinbaren kapitalistischen Alternativlosigkeit zu befreien und Veränderungsmöglichkeiten aufzuzeigen?
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Werner Plumpe kann dem Buch von Simon Sahner und Daniel Stähr nichts abgewinnen. Die Verfasser behaupten die Existenz einer mächtigen Sprache des Kapitalismus, von der wir uns befreien sollen, um alternativen Lebens- und Wirtschaftsweisen die Tür zu öffnen, die es laut Plumpe schlicht nicht gibt. Was die Autoren an Phrasen und Jargon aus der Rede von Politikern und Interessenvertretern herausdestillieren, findet Plumpe nicht uninteressant, doch all dies als unser Denken beherrschende Sprache des Kapitalismus zu kennzeichnen, findet er "forsch" und leicht zu widerlegen. Sprachkritische Aspekte hingegen behandeln die Autoren gar nicht, stellt Plumpe enttäuscht fest.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Verblendung durchschaut: Simon Sahner und Daniel Stähr versuchen sich in Kapitalismus- als Sprachkritik
"Die Sprache des Kapitalismus": Der Titel des Buches weist auf einen klaren und eindeutigen Gegenstand hin, den die Verfasser dann leider nicht behandeln. Stattdessen weisen sie bereits in der Einleitung darauf hin, dass sie darunter "bestimmte Sprachbilder und Metaphern, Redewendungen und Phrasen, Mythen und Erzählungen, wie einzelne Begriffe, mit denen ökonomische Zusammenhänge beschrieben und erzählt werden", verstehen wollen. Dieses "Verständnis" ist so umfassend wie unpräzise. Ob die Sprache des Kapitalismus eine klare Grammatik und einen definitiven semantischen Gehalt besitzt, einen eindeutigen Ursprung und historischen Ort hat, sich auf einen abgegrenzten Gegenstand bezieht, welchem historischen Wandel sie unterliegt und was dabei die dynamischen Kräfte sind, wie weit sich diese Sprache trennscharf von der allgemeinen ökonomischen Semantik unterscheiden lässt, ob sie weltweit und in allen Sprachen die gleiche ist: Nach Antworten auf diese Fragen zu suchen interessiert die Verfasser, einen Kulturwissenschaftler und einen Ökonomen, im Grunde nicht.
Es ist vielmehr alles ganz einfach: Steckten wir nicht über beide Ohren in eben der Sprache des Kapitalismus, dann fiele es uns viel leichter, Alternativen zu ihm zu entwerfen. Da wir aber unsere Welt semantisch in dem eingerichtet haben, was die Verfasser zur "Sprache des Kapitalismus" erklären, sehen wir mögliche Alternativen kritisch oder haben nicht die nötige Phantasie, uns etwas anderes, eine postkapitalistische Welt eben, wie sie die Journalistin Ulrike Hermann im Anschluss an die englische Kriegswirtschaft des "Zweiten Weltkrieges vorschlägt, überhaupt vorzustellen. Stattdessen haben wir Angst vor Deindustrialisierung, Wohlstandsverlust und Degrowth, weil uns die Sprache des Kapitalismus in tausend Variationen suggeriert, wir würden etwas verlieren, gäben wir seine Segnungen auf.
Diese Sprache, so unterstellen Simon Sahner und Daniel Stähr, ist mächtig, ja hindert uns daran, die Welt anders zu sehen als durch eine rosarote Wachstumsbrille. Da gilt es Abhilfe zu schaffen. Zum Glück, kann der unbedarfte Mensch da nur sagen, ist die "Sprache des Kapitalismus" nicht so mächtig, dass die Verfasser sie nicht durchschaut hätten. Und das lassen sie uns wissen. Das Buch ist, so gesehen, eine Art Zurückweisung der Kritik, die mit ökonomischen Argumenten den Sinn und die Möglichkeit eines angestrebten antikapitalistischen Umbaus der Wirtschaft, der zugleich politischen, ökologischen und sozialen Zielen dienen soll, infrage stellt.
Das Buch besteht aus einer Art Blütenlese des in der Tat häufig phrasenhaften Jargons, der in der Wirtschaftspolitik, namentlich in der Rede von Politikern und Interessenvertretern, so beliebt wie verbreitet ist. Dass auch die Wirtschaftswissenschaft, wie sollte es anders sein, ihre Aussagen in einer Sprache fassen muss, die man sich anders vorstellen könnte, überrascht nicht. Doch einfach zu unterstellen, die "Rhetorics of Economics" bedienten eine Sprache des Kapitalismus, und das auch noch so, dass sie unser Denken beherrsche, ist schon forsch. Nicht jedes misslungene Sprachbild folgt einer kapitalistischen Logik, die ohnehin nur schwer auszumachen ist. Vor allen Dingen überraschen die Annahmen über ihre Wirkmächtigkeit.
An Kritik des Kapitalismus mangelt es in der Gegenwart nicht, und ein kurzer Blick in die Dogmengeschichte der Ökonomie und der praktischen Philosophie hätte den Autoren gezeigt, dass es so etwas wie ein vermeintlich vorherrschendes kapitalistisches Sprachbild zu keiner Zeit gab. Die Wirtschaft und ihre Ordnung sind seit jeher umstritten. Die Kontrastierung des "guten Lebens" mit der "Chrematistik", also dem Streben nach dem Mehr, nach dem Geld, stammt von Aristoteles, und der war bekanntlich kein Befürworter des "Mehr". Kurz: Es gibt eine Vielzahl von Stimmen in diesem bis heute anhaltenden Streit, die sich nicht so einfach auf den Begriff bringen lässt, wie die Autoren das zu glauben scheinen. Es geht im Buch aber letztlich auch gar nicht um sprachkritische Studien, die ihren Anspruch einlösen könnten. Dazu fehlt jede Definition dessen, was Wesen, Ursprung und Dynamik der Sprache des Kapitalismus - einmal unterstellt, es gebe sie - überhaupt sein sollen. Der Leser bleibt hier im Dunkeln beziehungsweise soll durch eine Vielfalt an Stilblüten eher überwältigt als überzeugt werden. Worum es letztlich geht, ist die Denunziation der ökonomischen Vernunft als "Sprache des Kapitalismus".
So soll die Kritik an der sich derzeit vollziehenden ökologischen Transformation der Wirtschaft, die in der Tat mit deren Erfolgen oder Misserfolgen argumentiert, sprachlich delegitimiert werden. Es wäre schon interessant, zu erfahren, ob es in den Augen der Verfasser überhaupt sprachliche Möglichkeiten gibt, sich mit der von ihnen als notwendig beschriebenen Transformation zur Verhinderung einer vermeintlichen Klimaapokalypse kritisch auseinanderzusetzen, oder ob nicht jede entschiedene Kritik von Anfang illegitim ist, weil sie mit sprachlichen Mitteln arbeitet, die man ja als kapitalistisch denunzieren kann.
Das Buch ist wohl fertiggestellt worden, als sich Kritik an der Praxis dieser ökologischen Transformation bereits deutlich artikulierte. Die Maxime scheint zu sein: Wenn wir die Kritik schon nicht aus der Welt schaffen können, als Verblendung zurückweisen können wir sie wohl. Doch bleibt ein ökonomischer Ruin auch dann ein Ruin, wenn er in der Sprache des Postkapitalismus beschrieben wird. Die ökonomische Realität, für die Verfasser wahrscheinlich bereits ein Begriff der kapitalistischen Sprache, lässt sich nicht einfach dadurch ausblenden, dass ich sprachlich so tue, als gäbe es sie gar nicht. Das Argument wird auch dadurch nicht besser, dass man den Verzicht ("englische Kriegswirtschaft") propagiert. Das Plädoyer für etwas, dass die Menschen in England ja so schnell wie möglich wieder loswerden wollten, ist überdies geradezu unernst: Sicher kann man unter solchen Bedingungen ausreichend zu essen bekommen, aber den Gang zum Zahnarzt oder die Krebsbehandlung hätte man dann doch schon gern auf heutigem Niveau.
Der nach England emigrierte niederländische Arzt mit hugenottischen Wurzeln Bernard Mandeville schloss sein Spottgedicht von der Bienenfabel, das zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts Aufsehen erregte, mit dem Vers: "Wer will / dass eine goldene Zeit /zurückkehrt / sollte nicht vergessen / man musste damals Eicheln fressen". Mandevilles Spott rief die anglikanische Geistlichkeit auf den Plan, die nicht zugestehen wollte, dass eine nach ihren Vorstellungen eingerichtete Welt vielleicht auch eine arme Welt sein könnte. Das erschien ihr so blasphemisch wie heute den Verteidigern der ökologischen Transformation deren Kritik "kapitalistisch". In der Sache behielt Mandeville recht. WERNER PLUMPE
Simon Sahner und Daniel Stähr: "Die Sprache des Kapitalismus".
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2024. 304 S., geb., 24,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.
Eine erhellende Sprachkritik mit vielen Aha-Momenten Anna Jungen SRF 20240911