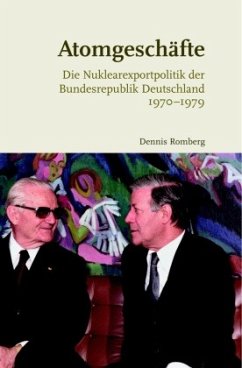Die westdeutsche Atomindustrie der 1970er Jahre hatte ein Absatzproblem: Nachdem sie in den 1950er und 1960er Jahren stark subventioniert wurde, sollte sie nun die langersehnten Exporterfolge erzielen. Die sozialliberale Koalition förderte aktiv den Export von Atomkraftwerken, Uran-Anreicherungsanlagen und Wiederaufbereitungstechnologie an diktatorische Regimes in Lateinamerika, Südafrika und den Iran. Unter dem Schlagwort "Einbindung durch Kooperation" setzte sie sich gegen schärfere internationale Kontrollen und Absprachen ein. Laxe Sicherheitsbestimmungen beim Export waren ein Standortvorteil für die Atomkraftwerke made in Germany. Dennis Romberg analysiert die Nuklearexportpolitik der Bundesrepublik in den 1970er Jahren systematisch und umfassend. Er betrachtet die Nuklearexporte der Bundesrepublik im Zusammenspiel mit der außenpolitischen Emanzipation der Bundesregierung, den Konflikten mit den USA, der innenpolitischen Kritik der aufkommenden Anti-AKW-Bewegung und dem internationalen Kontrollregime zur Nichtverbreitung von Atomwaffen. Dabei wird deutlich, wie die sozialliberale Koalition entgegen ihren eigenen Behauptungen das Nichtverbreitungsregime untergrub.

Hauptsache, das Geschäft blüht: Nach diesem Motto verfuhren die Bundesregierungen auch im Bereich des in jeder Hinsicht sensiblen Exports von atomarer Technologie.
Von Ralph Rotte
Dass die bundesdeutsche Wirtschaft mit durchaus tatkräftiger Rückendeckung durch die Bundesregierung in der Vergangenheit immer wieder sicherheitspolitische und humanitäre Zielsetzungen der Außenpolitik konterkariert hat, ist bekannt. Man denke nur an die Lieferung von Anlagen und Rohstoffen für die Produktion chemischer Waffen im Irak und in Syrien in den 1980er und 1990er Jahren. In seiner beeindruckend aufwendig in deutschen, amerikanischen und EU-Archiven recherchierten Dissertation weist Dennis Romberg nun nach, dass auch im Bereich der Proliferation von Atomtechnologie die wirtschaftlichen Interessen der sozialliberalen Koalition der 1970er Jahre - mit weitgehender Unterstützung durch die CDU/CSU-Opposition - klaren Vorrang vor Bedenken hinsichtlich einer Schwächung des nuklearen Nichtverbreitungsregimes hatten. Denn "Nuklearexporte dienten auch der Selbstvergewisserung der Bundesrepublik als Industrienation und waren dementsprechend in die Außenhandelspolitik und Energiepolitik der Bundesrepublik eingebettet. (...) Die Bundesrepublik war in diesem wirtschaftlichen Krisenjahrzehnt besonders abhängig vom Weltmarkt, und die westdeutsche Wirtschaft erwies sich als besonders sensibel gegenüber weltwirtschaftlichen Einflüssen." Entsprechend bedeutend war der Einfluss von Großunternehmen wie dem Energieanbieter Steag, dem Chemie- und Elektrokonzern Veba oder dem Kraftwerkhersteller KWU, einer gemeinsamen Tochter von Siemens und AEG, auf das Verhalten der politischen Akteure.
Offiziell stützte die Bundesregierung ihre Atomexportpolitik auf die Philosophie der "Einbindung durch Kooperation", wonach Nuklearexporte in Nichtmitgliedstaaten des Nichtverbreitungsvertrages (NPT) mit "fullscope safeguards" verbunden werden sollten, um sie indirekt in das Nonproliferationsregime einzubinden und zu einem späteren Beitritt zum NPT zu bewegen. Tatsächlich krankte dieser Ansatz jedoch an zwei fundamentalen Mängeln: Erstens wogen in der Praxis die Exportinteressen der deutschen Wirtschaft deutlich schwerer als das sicherheitspolitische Nichtverbreitungsziel. So wurden sicherheitspolitische Bedenken, insbesondere der amerikanischen Regierung, als von ökonomischem Konkurrenzdenken motiviert abgetan, und wiederholt wollte die Bundesregierung "den Verkauf (...) nicht durch Verhandlungen über Sicherheitsmaßnahmen oder den Beitritt zu Nichtverbreitungsinitiativen belasten". Zweitens bedeutete er "eine immanente Diskriminierung. Staaten, die den NPT schon unterzeichnet hatten, sollten noch weiter eingebunden werden als diejenigen, die diesen Vertrag noch nicht unterzeichnet hatten. Damit sank jedoch der Anreiz für Staaten mit eigenem Atomprogramm, den Vertrag zu akzeptieren, und es wurden beim Zugang zur Nukleartechnik relative Schranken errichtet, keine absoluten."
Dies zeigt sich deutlich anhand der vier von Dennis Romberg en détail untersuchten Nuklearbeziehungen der Bundesrepublik mit Brasilien, Iran, Argentinien und Südafrika. So schlussfolgert der Verfasser etwa hinsichtlich der Geschäfte mit Brasilien: "Keine Rolle (...) spielten Überlegungen, mit einer Militärdiktatur auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung der Kernenergie zusammenzuarbeiten." Zudem standen die Parteien im Bundestag und das Parlament insgesamt "dem deutsch-brasilianischen Abkommen gänzlich unkritisch" gegenüber, während die teilweise massive Kritik vor allem aus den Reihen der Jusos, der Anti-Atomkraft-Bewegung und Teilen der Presse, etwa der F.A.Z., kam. "Ebenfalls prototypisch ist die Ignoranz einiger Stellen der Bundesregierung hinsichtlich möglicher brasilianischer Atombombenpläne." So stellte etwa das Bundesforschungsministerium die eigene Vertragstreue über die sukzessive immer deutlicher werdenden Bemühungen der brasilianischen Militärs um die Anreicherung von Uran.
In ähnlicher Weise fokussierte auch die Nuklearexportpolitik gegenüber Iran vor allem auf exportökonomische Aspekte. Ungeachtet gravierender Bedenken der Vereinigten Staaten gegenüber dem Streben des Schahs nach einer nuklearen Bewaffnung des Landes sowie wachsender Zahlungsschwierigkeiten und innenpolitischer Probleme des Regimes hielten die Bundesregierung und die KWU lange am Geschäft mit Iran fest, welches den Bau mehrerer Atomkraftwerke vorsah. Noch im Oktober 1978 reiste Bundeswirtschaftsminister Lambsdorff nach Teheran, "damit die deutsch-iranischen Geschäftsbeziehungen nicht ins Stocken gerieten". Erst Mitte 1979, vier Monate nach der Abdankung des Schah und der Rückkehr Ajatollah Chomeinis, stieg die deutsche Seite angesichts verpasster Zahlungsziele der Iraner, chaotischer Zustände auf den Baustellen und der antimodernistischen Züge der islamischen Revolution aus den Verträgen aus.
Die nuklearpolitischen Verhandlungen mit Argentinien wiederum waren sehr deutlich vom Wettbewerb der deutschen Unternehmen mit vor allem kanadischen Anbietern geprägt, welche zunächst erfolgreicher waren, bevor sich die argentinische Regierung angesichts der deutsch-brasilianischen Kooperation 1975 wieder an die Deutschen wandte, von denen man sich offenbar einen leichteren Technologietransfer erwartete. Die deutschen Unternehmen und die Bundesregierung zeigten sich offen: "Weder der Militärputsch noch die Befürchtungen zum Bau einer Atombombe verhinderten eine Wiederannäherung bei der nukleartechnischen Zusammenarbeit. (...) Bedenken im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Argentinien gab es vor allem im Auswärtigen Amt, das negative Folgen für die Nuklearkooperation mit Brasilien fürchtete." Zugleich demonstrierte das Verhalten der Bundesregierung im Fall Argentiniens ihre typische "Vorgehensweise bei Nukleartechnikkooperationen und -exporten: Zunächst nahm die Bundesregierung Verhandlungen auf, um auszuloten, wie weit die Kooperation gehen könnte. Wenn die Zusammenarbeit vorteilhaft schien, trieb man die Verhandlungen schnell soweit voran, dass man trotz innenpolitischer Bedenken oder Bedenken der USA kaum davon zurücktreten konnte, ohne dass die westdeutsche Wirtschaft oder das Partnerland unzufrieden sein würde. Dies nahmen die Ministerien, die die Kooperation befürworten, dann als Rechtfertigung, um die entsprechende Nuklearkooperation zum Abschluss zu bringen und grundsätzlicher Kritik auszuweichen."
Etwas anders gestaltete sich die Nuklearkooperation mit Südafrika. Aufgrund der massiven Kritik in den Parteien und der Zivilgesellschaft sowie der Angst vor einem Renommeeverlust gegenüber den anderen afrikanischen Staaten forcierte die Bundesregierung den Export von Atomkraftwerken an das Apartheid-Regime weniger stark als in den übrigen Fällen. Entsprechend forderte man die südafrikanische Regierung zum Beitritt zum NPT auf, was diese aufgrund ihrer Strategie der "deliberate ambiguity" ablehnte. Dass die Bundesrepublik mit ihrer Nuklearpolitik und der damit verbundenen Geringschätzung sicherheitspolitischer Bedenken von Partnerländern zunehmend isoliert war, zeigt sich darin, dass die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien, die zusammen mit der UdSSR Druck auf Südafrika ausübten, sein militärisches Atomprogramm fallenzulassen, die Bundesregierung nicht in ihren diesbezüglichen Austausch von Geheimdienstinformationen einbezogen.
1977 führten der Druck der Amerikaner und anderer Mitglieder der Nuclear Supplier Group schließlich dazu, dass die Bundesregierung nolens volens einen Exportstopp für sensible Wiederaufbereitungsanlagen und -technologien verhängte. "Zu dieser Neupositionierung der Nuklearpolitik der Bundesregierung trug insbesondere die Änderung der französischen Haltung bei. Die französische Regierung begann, die westdeutsche Philosophie der ,Einbindung durch Kooperation' zu kritisieren, da die Bundesregierung damit zu sehr auf die Rechtfertigung der Exporte setzte, während eine selbständige europäische Nuklearpolitik nur durch identische Interessen Frankreichs und der Bundesrepublik durchgesetzt werden könne. Wenn Frankreich als Verbündeter gegen die amerikanische Haltung der Technologieverweigerung wegfiel, drohte die Bundesrepublik isoliert und als zu nachlässig in Bezug auf Nuklearexporte dazustehen. (...) Schmidt selbst verteidigte noch 1979 das Vorgehen der Bundesregierung und die Inkaufnahme der Konflikte mit den USA, ohne Einsicht oder Kompromissbereitschaft erkennen zu lassen." Außerdem erfolgte die Einrichtung eines Nuklearkabinetts, welches außen- und sicherheits- sowie wirtschaftspolitisch Interessen zusammenführen sollte, jedoch ohne die langfristige Ausrichtung vergleichbarer Institutionen im französischen oder amerikanischen Kontext.
Kontrastiert werden die vier Fallstudien schließlich durch einen Vergleich mit der bundesdeutschen Nuklearkooperation mit der Sowjetunion. Der Moskauer Vertrag von 1970 und die Entspannungspolitik eröffneten die Möglichkeit, mit Zustimmung der Nato-Partner inklusive der Amerikaner mehrere Initiativen zur Zusammenarbeit zu ergreifen, von denen die erfolgreichste der Bezug von angereichertem Uran für deutsche Atomkraftwerke aus der UdSSR war. Durch die Anreicherung von Uran "wurde erfolgreiche Entspannungspolitik mit anderen Mitteln betrieben". Demgegenüber scheiterten die Bemühungen um den Bau eines Atomkraftwerkes in Kaliningrad Ende der 1970er Jahre an den sich wieder verstärkenden Spannungen zwischen West und Ost. Wie sehr sich die Bundesregierung um ausländische Aufträge für bundesdeutsche Nuklearunternehmen bemühte, zeigt sich jedoch daran, dass Bundeskanzler Schmidt angesichts großer betriebswirtschaftlicher Probleme bei KWU Mitte 1977 (vergeblich) in Ost-Berlin anfragte, ob nicht die DDR ein westdeutsches AKW kaufen wolle.
Entsprechend kommt Dennis Romberg im Fazit seiner sehr lesenswerten und akribisch begründet kritischen Arbeit zu dem Schluss, dass die Bundesregierung "von der westdeutschen Atomindustrie, die im Verlauf der 1970er Jahre immer stärker auf Nuklearexporte angewiesen war", gedrängt wurde, solche anzubahnen und zu forcieren. "Wie sehr dabei das Konzept ,Einbindung durch Kooperation' die tatsächlichen Exportinteressen kaschierte und wie wenig glaubwürdig der Einsatz der Bundesregierungen für ein wirksames Nichtverbreitungsregime war, wurde insbesondere bei den untersuchten Verhandlungen über die Nuklearexporte nach Brasilien, in den Iran, nach Argentinien und nach Südafrika deutlich." Diese exportwirtschaftlich getriebene Herangehensweise an die Frage des Umgangs mit sensibler Hochtechnologie führte schließlich so weit, dass die letztlich als Interessenvertreter der deutschen Industrie agierenden Bundesregierungen "nicht nur die Einbindung der betreffenden Staaten in das Nichtverbreitungsregime verfehlten, sondern dieses letztlich sogar untergruben".
Damit macht der Verfasser aber über sein eigentliches Thema hinaus klar, welche sicherheitspolitischen wie diplomatischen Probleme und Risiken mit einer Außenpolitik verbunden sind, welche durch die extreme Exportabhängigkeit der deutschen Wirtschaft quasi zum Handelsvertreter deutscher Güter und Dienstleistungen degradiert wird. Für die Erfolgsaussichten durchaus aktueller Parallelen, etwa der Hoffnung auf eine Einbindung eines zunehmend aggressiv auftretenden Chinas in eine regelbasierte internationale Ordnung durch enge wirtschaftliche Kooperation, lässt dies nichts Gutes erwarten.
Dennis Romberg: "Atomgeschäfte". Die Nuklearexportpolitik der Bundesrepublik Deutschland 1970-1979.
Ferdinand Schönigh Verlag, Paderborn 2020. 413 S., geb., 109,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Ralph Rotte zieht nicht eben Zukunftshoffnung aus Dennis Rombergs Darstellung der Nuklearbeziehungen zwischen der Bundesrepublik und Brasilien, Iran, Argentinien und Südafrika. Was der Autor in seinen Fallstudien laut Rezensent sehr kritisch herausarbeitet, die starke exportökonomische Note von Verhandlungen und Abkommen, scheint Rotte indes lesenswert. Die sicherheitspolitischen und diplomatischen Schwierigkeiten einer Außenpolitik, die an die Wirtschaft gebunden ist, werden für Rotte offenbar.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH