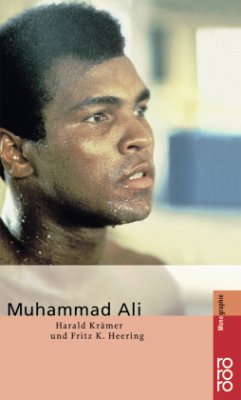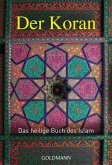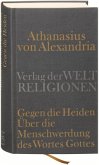Muhammad Ali (1942-2016) gehörte zu den größten Sportlern aller Zeiten. Seine Markenzeichen: Eleganz und Beweglichkeit im Boxring, einzigartige Schlagkombinationen und - die Lust am provozierenden Auftritt. Nicht zuletzt dank seiner politischen Aktivitäten hat er eine Popularität und Bedeutung erlangt wie kein anderer Sportler im 20. Jahrhundert.

Nie herumgehangen: Eine fundierte Biographie über Muhammad Ali
Wem bereits vor seinem Tod die Ehre zuteil wird, daß Biographien über ihn verfaßt werden, existiert bekanntermaßen als eine Art Betriebsunfall, den man "lebende Legende" nennt. Muhammad Ali, der sich selbst oft genug mit dem Zusatz "größter Boxer aller Zeiten" versieht, genießt dieses zweifelhafte Glück seit längerem. Seitdem er 1975 im Lektorat mit der Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison selbst einen Roman über sein Leben herausgebracht hat, häufen sich Bücher und Jubiläumsessays über ihn. Nun, pünktlich zum sechzigsten Geburtstag, erscheint eine Monographie in der Rowohlt-Reihe, die sich normalerweise erst dann Berühmtheiten widmet, wenn diese gestorben sind.
Im Falle Alis aber war der Ruhm wohl zu erdrückend. Schließlich, so schicken die Verfasser Harald Krämer und Fritz Heering in ihrer Einleitung vorweg, "dürfte es in den sechziger und siebziger Jahren kein bekannteres Gesicht auf dem Planeten gegeben haben als seines". Damit aber benennen sie gleich zu Anfang nicht nur die Fallhöhe seiner Laufbahn, sondern auch die Hauptgefahrenquelle beim Schreiben über den dreimaligen Weltmeister im Schwergewicht: Wie kaum ein Zweiter verführt Ali zur Ikonisierung.
Was nicht zuletzt an der Sportart liegt, die er perfekt beherrschte. Haftet Boxen doch (ähnlich wie dem Stierkampf) als einem Ringen auf Leben und Tod seit jeher eine mythische Aura an, die Literaten von Hemingway über Brecht bis hin zu Musil faszinierte. Und wenn von Ali die Rede ist, greifen nicht nur eingefleischte Bewunderer und Boulevardjournalisten gern zu Superlativen. Vom "Herkules Salvator" bis hin zur regelrechten "Alimania", die ausbrach, als der inzwischen schwerkranke Champion in Atlanta 1996 das Olympische Feuer entzündete: das Boxidol wird als Verkörperung des american dream bis heute geradezu kultisch verehrt.
Weshalb es immer wieder Autoren reizte, dem "Gesamtkunstwerk" Ali auf die Schliche zu kommen. Jan Philipp Reemtsma witterte dabei zuletzt sogar Diskursives hinter der Art, wie Ali boxte. Den späten Kämpfen unterstellte Reemtsma eine "bewußte Ironisierung", wonach der Profi im Ring gleichsam von der Klassik hinüber in die Postmoderne getänzelt sei. In Krämers und Heerings wohltuend nüchterner Darstellung erscheint der gealterte Ali keineswegs als still an Parkinson vor sich hin leidender Mann. Ob als Werbeträger oder als Kommentator der Terroranschläge von New York: Der Superstar kennt weiterhin die Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie. Aus der Sammlung der Anekdoten, die über Ali kursieren, erfahren wir etwa den "Schöpfungsmythos". Danach kam der Zwölfjährige angeblich nur deshalb zum Boxen, weil man ihm sein Fahrrad gestohlen hatte. Joe Martin, der weiße Polizist, an den sich der Junge wandte, wurde sein erster Trainer. "Bevor man losgeht, um jemanden zu verprügeln", riet Martin dem Sohn eines farbigen Schildermalers, solle man "etwas davon verstehen".
Aufgewachsen als "Cassius Clay" und Sohn einer Mittelstandsfamilie in Louisville, trainierte der Boxanfänger hart. "Kein Herumhängen, keine Zigaretten, kein Alkohol, keine Mädchen." Clay wollte nach oben. Und schon nach seinem allerersten Sieg im Ring verkündete er lauthals, daß er "der Größte" sei. Ein ständig wiederholtes Mantra, das im atemberaubenden Tempo von nur zehn Jahren zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung wurde. Als Clay mit 22 Jahren gegen Sonny Liston zum ersten Mal den Weltmeistertitel errang, avancierte er schnell zur Symbolfigur der schwarzen Emanzipationsbewegung. Nachdem viele zunächst seine Sympathie mit den radikalen Black Muslims irritiert hatte (derentwegen er den "Sklavennamen" Clay ablegte), wurde der Boxer nach seiner Weigerung, am Vietnamkrieg teilzunehmen, zum Vorbild einer protestierenden Jugend. Standhaft nahm er das dreieinhalbjährige Berufsverbot hin. Das trug ihm den Nimbus der Unkorrumpierbarkeit ein. Tatsächlich war Ali bis dahin der erste schwarze Profiboxer, der mit dem weißen Establishment brach und danach in den Ring zurückkehren konnte.
Krämers und Heerings mit Zeitzeugenberichten gespickte, ebenso distanziert wie einfühlsam gehaltene Monographie verschweigt nicht die "Schattenseiten" Alis: Seine Triebhaftigkeit, die sich in zahlreichen Affären und vier Ehen niederschlug. Sein Sexismus, demgemäß er die Frauenbewegung als "Tick der Weißen" abtat. Und natürlich seine Selbstherrlichkeit. Keine Gelegenheit ließ Ali aus, Gegner schon vor dem Kampf zu demoralisieren. Sonny Liston klingelte er nachts aus dem Bett. Er prophezeite die Runden, in denen er zum K.o. ansetzen würde. Und er ließ Schmähtiraden und -gedichte vom Stapel, die er sogar auf T-Shirts und Schallplatten vervielfältigte. Die meisten haben ihm mittlerweile verziehen. Außer seinem Schicksalspartner Joe Frazier. Die Häme, mit der Ali ihn einst wegen seines South-Carolina-Akzents verspottete, konnte er nicht verwinden.
GISA FUNCK.
Harald Krämer, Fritz K. Heering: "Muhammad Ali". Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 2001. 160 S., br., 8,50 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Normalerweise widme sich diese Rowohltreihe den Berühmtheiten erst, wenn sie schon gestorben sind. Doch Gisa Funck ist angenehm überrascht: Die Autoren der vorliegenden Monografie haben hier keine Heiligsprechung Alis betrieben. Das Buch sei "ebenso distanziert wie einfühlsam gehalten" und mit Zeitzeugenberichten gespickt. In der zurückhaltenden Darstellung würden auch die Schattenseiten des weltbekannten Boxers nicht verschwiegen: seine Triebhaftigkeit, sein Sexismus, dem gemäß er die Frauenbewegung als 'Tick der Weißen' abgetan hatte. Auch der gealterte, parkinsonkranke Ali erscheine keineswegs als bedauernswertes leidendes Opfer. Ob als Werbeträger oder Kommentator der Terroranschläge von New York: der Superstar kenne weiterhin die Regeln der "Aufmerksamkeitsökonomie".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH