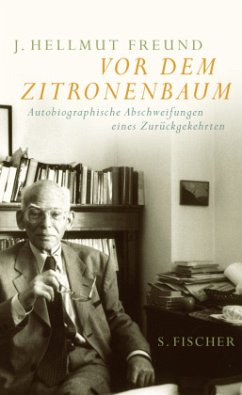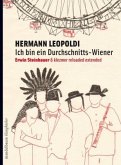Sein unerschöpfliches Wissen, sein erstaunliches Gedächtnis, seine Fähigkeit, im Gespräch große Bögen zu schlagen und überraschende Zusammenhänge herzustellen, wurden gerühmt und bewundert. Doch allen Bitten, seine Erinnerungen aufzuschreiben, hat er widerstanden - fast bis zuletzt. Gespräche bildeten die Grundlage zu diesem Buch. Voller Witz und Charme erzählt Hellmut Freund von Kinder- und Schülerjahren in Berlin, vom bürgerlich-intellektuellen Elternhaus, von frühen literarischen Eindrücken. Die Erfahrungen als einziger jüdischer Schüler in der Klasse, die schwere erste Zeit in der Emigration schildert er ohne Bitterkeit. Dankbar erfüllt beschreibt er die lebensbestimmenden Begegnungen und Freundschaften, die aus seiner journalistischen Arbeit in Montevideo und Buenos Aires erwuchsen. Bis zur Rückkehr nach Deutschland im Jahr 1960 reicht dieser Bericht. Vierundvierzig Jahre, in denen Hellmut Freund als Lektor das Programm des S.Fischer Verlags mitgestaltet hat, sind mit einer Auswahl der von ihm verfassten Texte zu "seinen" Büchern dokumentiert. Eine Gesprächsaufzeichnung aus dem Jahr 1993 liegt dem Buch als CD bei.

Erhaltendes Denken: Die Erinnerungen von J. Hellmut Freund / Von Lorenz Jäger
Gäbe es einen eigenen jüdischen Adel, J. Hellmut Freund hätte ihm angehört. Die Geschichte seines Lebens, das ihn von Berlin nach Uruguay und erst spät, 1960, wieder nach Deutschland führte, wo er bis zu seinem Tod im vergangenen Jahr als Lektor und Ratgeber des S. Fischer Verlags wirkte - diese Geschichte hat einen so großen Fonds des Wohlwollens, vielleicht sollte man schlicht sagen: des gut Aspektierten, eines dem Finstersten abgerungenen Glücks, daß die Lektüre zum reinen Vergnügen wird.
"Mein Vater", so schildert Freund die Vorbereitungen zur Emigration, "nahm mich am Spätnachmittag des 21. Januar 1939, eine Woche vor der Auswanderung, mit zum Abschiedsbesuch bei Max Planck; es war, als sollte der Einundachtzigjährige, der ein wissenschaftlicher Revolutionär und seiner Erscheinung nach ein Klassiker war, uns seinen Segen geben. Er sprach vom erhaltenden Denken in Generationen."
Das erhaltende Denken! Planck hatte einen Orakelspruch geäußert, den man gut und gern als bündigste Formel für die Leistung von Freund nehmen kann. Und wie jedes echte Orakel war die Formulierung mehrdeutig. Erhalten hat Freund sich zunächst sein Judentum, in einer intellektuell kultivierten Form, aber eben doch obstinat und in Kernfragen nicht nachgebend. Doch dieses Judentum war so sehr von der deutschen Kultur getränkt, daß man bei der Lektüre des Buches glaubt, erst jetzt der Dichte der deutsch-jüdischen Verbindungen innezuwerden, die in den dreißiger Jahren zunächst einmal endete. Aber man muß Freund selbst hören, wie er vom einen aufs andere und immer weiter kommt, vom Laubhüttenfest zur Laubenidylle in Vossens "Luise", und von da zur "Gartenlaube", dem Inbegriff des Kleinbürgerlich-Biedermeierlichen, Unpolitisch-Deutschen; wie er selbst für die Marlitt als Schriftstellerin dieser Sphäre noch ein gutes Wort findet. Die herrlichsten Abschweifungen prägen seinen Stil, es ist der eines etwas großväterlichen, um die vergehende Zeit unbesorgten Erzählens.
Ab der Mitte der dreißiger Jahre wurde der jüdische Religionsunterricht in den Privaträumen des Lehrers erteilt - es fehlten mehr und mehr die Schüler, deren Eltern sich schon früher zur Auswanderung entschlossen hatten. Dennoch wurde auch dieser Unterricht von der Schule anerkannt. Und mochte die offizielle Atmosphäre vergiftet sein, so kam es doch immer auf den einzelnen und seinen Anstand an: ",Sorgen Sie dafür, daß wieder ein Religion Sehr gut oben auf dem Zeugnis steht', sagte mir vor unserem Abitur unser deutschnationaler Klassenlehrer Dr. Friedrich Mohr."
Und immer wieder ist man versucht, statt das Buch zu rezensieren, einfach aus ihm vorzulesen. Denn so gestaltete sich der Privatunterricht in jüdischer Religionslehre: "Als Kantorowsky in biblischer Geschichte auf Herodes zu sprechen kam, mimte und sang er das Finale der ,Salome' von Richard Strauss, statt der silbernen Schüssel mit dem Haupt Johannes des Täufers einen Teller balancierend."
Wenn man in Freunds Autobiographie die indiskreten, enthüllend-hämischen Anekdoten vermissen mag, die sonst der Lektüre von Lebensbeschreibungen ihre Würze geben, so wird man doch reichlich entschädigt durch die Dichte der überlieferten Szenen - Freund muß über ein erstaunliches Gedächtnis verfügt haben. Auch hier also "erhaltendes Denken".
Und dann der Lektor! Gut hundert Seiten dieses Bandes dokumentieren Freunds Tätigkeit für den Verlag, erst noch als Autor der "Neuen Rundschau", später dann im Frankfurter Haus. Würdigungen findet man, Klappentexte, Briefe an die Vertreter, die diesen das Programm nahebringen. Hier ist nun doch die Gelegenheit für eine melancholische Betrachtung: Wie viele Bücher erscheinen heute, auch in angesehenen Verlagen, in denen man auf jeder Seite die schiefen Sätze trifft und bemerkt, wie sehr das einfachste Sprachempfinden seither gelitten hat - und es sind nicht die oft getadelten Anglizismen, die stören, sondern die schlichten Fehler . . . aber hier, bei Freund, liest man eine schöne, ernsthafte, gleichmäßige Prosa. In der Dynastie der deutsch-jüdischen Fischer-Lektoren, die mit Moritz Heimann begann und sich in Rudolf Hirsch fortsetzte, war er vielleicht der letzte. Es mag sein, daß Freund, der musikalisch Hochbegabte, auch die Sprache zunächst hörte - und hier müssen wir einräumen, dem großen Thema der Musik und der Musiker-Freundschaften, das diese Erinnerungen durchzieht, nicht den gebührenden Raum gegeben zu haben.
Dem Buch ist ein Motto der indisch-türkischen Erzählungssammlung "Tuti-Nameh" vorangestellt: ,,Die Zunge ist der Dolmetscher des Herzens, das heißt, der Wert und der Adel des Menschen, sein Gutes und sein Böses, sein Lieben und sein Hassen und alle Zustände seines Innern werden durch die Rede offenbar." In diesem Fall, wie gesagt, der Adel.
J. Hellmut Freund: "Vor dem Zitronenbaum". Autobiographische Abschweifungen eines Zurückgekehrten. Berlin - Montevideo - Frankfurt". Hrsg. von Vikki Schaefer und Leo Domzalski. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2005. 577 S., Abb., mit CD, geb., 22,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Im Berliner Gesprächston: Die wundervollen Erinnerungen des langjährigen S. Fischer-Lektors J. Hellmut Freund
Klaus Harpprecht, der einst Verlagsleiter bei S. Fischer in Frankfurt war, nennt Hellmut Freund den Mann, vor dem er dort die größte Hochachtung empfand. Er sei ein leiser Mann gewesen, ein sehr leiser Mann. Das Buch jedoch, in dem Freund aus seinem Leben erzählt und das jetzt, anderthalb Jahre nach seinem Tod im vergangenen Jahr, erschienen ist, kennt leise Töne nur gelegentlich. Es ist nicht etwa laut im Stil oder anmaßend in seinen Ausführungen; es ist nur ganz einfach im Berliner Gesprächston zu Papier gekommen. Und der liest sich nun einmal so, als würde man, wenn man sich hier wirklich im Gespräch befände, nicht zu Wort kommen. J. Hellmut Freund, der langjährige Lektor des S. Fischer Verlages, erzählt mit Schwung und Freude.
Freund berichtet zunächst vom Leben seiner Familie in Berlin - sein Vater war Journalist -, vom Heranwachsen in der Stadt bis zum Abitur 1938 - er war, vermutet er, neben Marcel Reich-Ranicki der einzige Jude, der dort zu dem Zeitpunkt noch die Reifeprüfung ablegte - und von seinen Erfahrungen mit den Deutschen in Zeiten des zunehmenden, bald offiziellen Antisemitismus.
In einem zweiten, gleich langen Teil des Buchs wird das Leben in der Emigration vorgestellt. Die Freunds entkamen dem Schlimmsten in Deutschland gerade noch rechtzeitig nach Uruguay, nach Montevideo, wo der Vater bald eine deutschsprachige Zeitung redigierte. Auch den Sohn zog es zunächst in diesen Beruf; er tat sich vor allem als Musikkritiker hervor. In diesem Abschnitt ist ein Kapitel dem Dirigenten Fritz Busch gewidmet, und man übertreibt wohl kaum, wenn man die Begegnung mit ihm als schicksalhaft für das Leben des jungen Mannes ansieht.
So breit und lebendig Freund alles, was ihn umgab, in sein Erzählen hineinzunehmen versteht, so herausragend, vielleicht unvergesslich sind einzelne Passagen, die nachdenklich stimmen oder zum Lachen reizen. Beschämend für heutige Leser mag die Zuversicht sein, mit der die Freunds als Juden in Deutschland lebten. Und doch wird diese Zuversicht nicht ad absurdum geführt durch die Erfahrungen, die der Heranwachsende machte. Den Lehrern am Askanischen Gymnasium wird hohes Lob gezollt für ihr Verhalten gerade ihm, dem Juden gegenüber in den dreißiger Jahren, ebenso den Schulkameraden. Freund ist nicht der einzige Zeitzeuge, der solches mitteilt. Vielleicht sollte einmal von diesen Erfahrungen her das Lob des preußischen Gymnasiums angestimmt werden, wie es aus der Zeit der Weimarer Republik hervorging.
Die Berliner Nachbarn der Freunds, einfache Leute, versuchten zu helfen, als die Verhältnisse bedrohlicher wurden. „Frau Freund, es soll ja sehr viel jetzt hier passieren in Berlin . . . hier sind unsere Wohnungsschlüssel. Wenn sie hören, man kommt herauf, dann gehen Sie durch die Hintertür zu uns.” Mit großer Sorgfalt schildert Hellmut Freund das Leben der Juden im Berlin jener Jahre. Das Kapitel „Erwachsen werden in der Nazizeit” beginnt mit den Worten: „Ich bin atypisch, ich bin vom meisten verschont geblieben.”
Fritz Busch hatte sich schon länger in der Emigration befunden. Er lebte in Buenos Aires, seit 1936 war er argentinischer Staatsbürger. In Montevideo wollte Busch 1944 Bachs Matthäuspassion in spanischer Sprache aufführen. Die verantwortlichen Herren waren dagegen. „Das Präsidium des Instituts bat den Gastdirigenten höflich zu einer Besprechung, deren erschrockener Zeuge (und Dolmetscher) ich wurde. Ja, zu viel des Aufwands. Lieber Beethovens Neunte. Ob der Maestro sie kenne?”
Zum Rotwein zu lesen
Hellmut Freund besuchte die Bundesrepublik 1957. Drei Jahre später kehrte er für immer zurück, 1961 folgten die greisen Eltern dem Sohn. Vierzig Jahre sollte er von da an noch als Lektor bei S. Fischer arbeiten. Ein ungewöhnlicher dritter Teil des Buches versammelt Klappentexte und Briefe an Verlagsvertreter zu Büchern, die der Lektor als Liebhaber mit besonders guten Wünschen aus dem Hause gehen lassen wollte.
Mit allem bisher Aufgezählten ist aber noch nicht angesprochen, was tatsächlich den außerordentlichen Reiz dieser Autobiographie ausmacht. Es sind dies die im Untertitel angekündigten Abschweifungen. Wann immer von Musik die Rede ist, verliert der Erzähler seinen Faden, um einen anderen aufzunehmen, der in die Musikgeschichte, gerade die zeitgenössische führt. Das beginnt mit dem Deutschlehrer Dr. Carl Liederwald, „mein Lieblingslehrer”, der den „,Rosenkavalier siebzig Mal in der Oper gehört hatte, seine Frau nur fünfunddreißig Mal”. Freund schweift ab bis zum Erscheinen des Buchs „Der Rosenkavalier - Fassungen, Filmszenarium, Briefe” von 1971. Und schon im Zuge dieser Abschweifung ist bald von Verdi und seinem späten Librettisten Arrigo Boito die Rede, im weiteren wiederum Gegenstand weitaus umfangreicherer Abschweifungen: 1987 erschien der Briefwechsel„Verdi - Boito”, herausgegeben von Hans Busch, dem Sohn des Dirigenten. Im Klappentext vermerkt Lektor Freund: „Als Übersetzer aus dem Italienischen wahrt Busch die Diktion der Briefschreiber: Verdis rauhe und warme Bündigkeit, Boitos Anmut, Skrupelhaftigkeit und Noblesse.” So kann man auch über Freunds Autobiographie sprechen.
Wie empfiehlt man so ein Buch? „Nimm und lies” klingt zu pathetisch. Wer zwei Hosen hat, verkaufe eine und erwerbe dieses Buch - geht nicht, weil man für gebrauchte Beinkleider nicht genug bekommt, um dieses Buch zu bezahlen. Versuchen wir es so: Wer zwei, drei Tage frei hat, fahre in ein schönes Hotel in bezaubernder Landschaft. Er achte auf guten Rotwein und auch sonstige Freuden. Dann nehme er sich die Stunden zur Lektüre dieses Buchs. Besser kann man seine Zeit kaum zubringen.
JÜRGEN BUSCHE
J. HELLMUT FREUND: Vor dem Zitronenbaum. Autobiographische Abschweifungen eines Zurückgekehrten. Herausgegeben von Vikki Schäfer und Leo Domzalski. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2005. 577 Seiten, 22,90 Euro.
„Ich bin atypisch, ich bin vom meisten verschont geblieben”: J. Hellmut Freund (1919-2004)
Abb. aus dem besprochenen Band / Foto: Barbara Klemm, FAZ
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Eine Dienstleistung der DIZ München GmbH
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Besonders die Freundschaften zu Musikern gehörten zu den eindringlichsten Kapiteln der "autobiografischen Abschweifungen", berichtet Rezensentin Ursula Pia Jauch von einer überraschend frohgestimmten Lektüre. Denn obwohl der junge J. Hellmut Freund mit seiner jüdischen Familie nach Uruguay emigrieren musste, sei die erste Botschaft seiner Autobiografie die pure "Lust am Erzählen". Hinter Freunds solcherart bukolisch erzählter Berliner Kindheit mit allen Gerüchen und Abschweifungen macht die Rezensentin ein "ästhetisches Prinzip" aus, das sie "Großmut" nennt. Wo andere auf die zunehmend feindlichere Umgebung schauten, schreibe Freund "versöhnlich". Mit dieser Perspektive, so die Rezensentin gelinge es Freund, aus einer bitteren Erinnerung wie dem Ausreiseantrag der Familie erhebliche Komik zu ziehen. Die Rückkehr nach Deutschland, wo Freund vierundvierzig Jahre als Lektor des Fischer Verlags tätig war, ist der Rezensentin zufolge aber kaum noch "einen Exkurs wert".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH