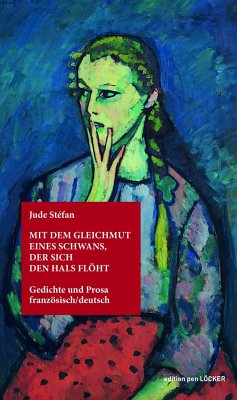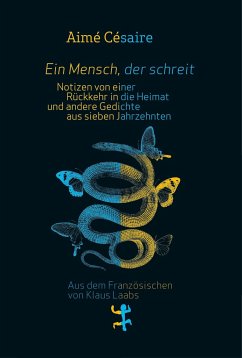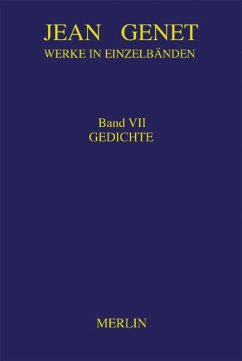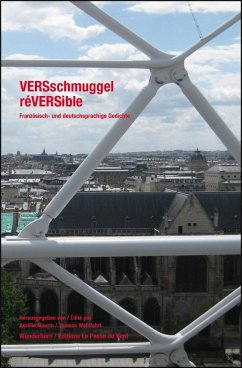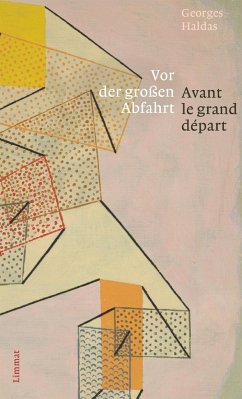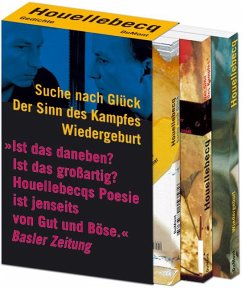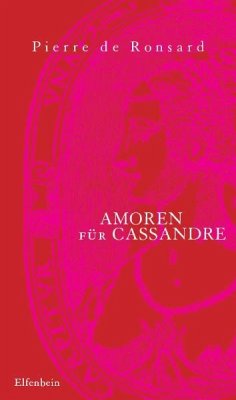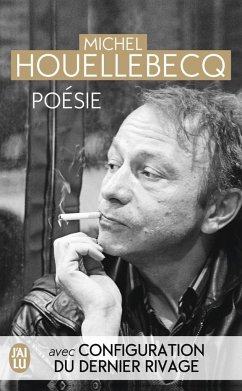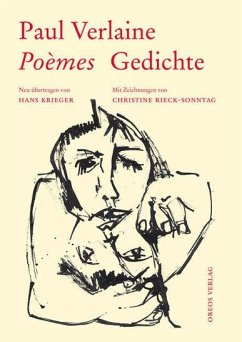stark.
In 65 sehr kurzen pointierten Texten ohne Interpunktion kreist "Den Toten bewachen" um die Sterblichkeit, eine Reflexion von medizinischer Tabu- und Schonungslosigkeit. Auslöser des Werks, das 1975 erstmals erschien, war der Tod von Giovannonis Mutter: Der Tod derjenigen, die ihm 1950 das Leben geschenkt hatte, war für den jungen Mann Ausgangspunkt einer zweiten Geburt, derjenigen als Dichter. Auf den ersten Band sollten viele weitere folgen. Den Erfolg des ersten sollte keiner wiederholen. Für die Leserschaft hat er sich zu einem zeitgenössischen Klassiker gemausert; die Literaturwissenschaft hebt ihn ebenfalls aufs Podest der kanonischen Autoren.
Die Gedichte wandern von allgemeinen Feststellungen zum genaueren Blick auf den Leib. Giovannoni betont seine Fragilität, seine Isoliertheit, seine Vergänglichkeit, er kommt aufs Sterben und schließlich dessen Verarbeitung zu sprechen. Dabei wechselt der genaue Blick auf einzelne Aspekte oder Körperteile ab mit allgemeinen Reflexionen. Schon einleitend macht der Dichter klar, dass Leiblichkeit für ihn Einsamkeit mitmeint: "man trifft sich nicht / jedem seine hülle". Radikal ist der Mensch auf seine Beschränktheit zurückgeworfen: "mit den geschlechtsorganen / glaubt man sich selbst zu verlängern / man lässt etwas wachsen / außerhalb seiner selbst / das ist alles". Von der unbelebten Außenwelt ist Hilfe nicht zu erwarten: "wir dachten / die dinge sind auf unserer seite / gegen die angst".
Stärker als Drama oder Roman ist Lyrik von einer religiösen und metaphysischen Sprache geprägt, das ist in der französischen Literatur nicht anders als in der deutschen. Stärker als in den anderen Gattungen haben daher Dichter der Moderne versucht, ihren Texten das "Schachern mit dem Ewigen" auszutreiben, wie Yves Bonnefoy sagt, ein Spezialist in Sachen Sterblichkeit. Giovannoni, der in seinem Brotberuf Sozialarbeiter in einer Pariser Psychiatrie war, stellt einen Extrempol dar: "Den Toten bewachen" entwirft "eine vollkommen diesseitige Dichtung", wie der Schriftsteller Éric Vuillard im Nachwort treffend festhält, eine "streng weltliche Sicht auf die Dinge". Das unterscheidet Giovannonis Band etwa von barocker Lyrik zum Thema: "Er muss ganz eng an den Dingen bleiben, hautnah am Toten, ohne eine Allegorie daraus zu machen oder eine Gelegenheit des Nachdenkens" - was nicht meint, dass Giovannoni den Gedanken keine Nahrung gäbe.
Die Genauigkeit in der Beobachtung anatomischer Details geht fließend über in - dem makabren Gegenstand zum Trotz - zutiefst poetische Spekulationen: "tief in den gliedern / stecken stümpfe / sie warten darauf / entdeckt zu werden". In vier Zeilen wird hier die Gebrechlichkeit des Menschen als das Potential verstümmelter Glieder entworfen - eine konkrete, makabre, einprägsame Form der Phantasie. Der Tod selbst kann an ebensolchen physischen Sollbruchstellen verortet werden: "man kommt zurück / in die innere kammer / des ursprungs / drei minuten / diesmal / reißt die membran / nach innen".
Es ist wunderbar, dass der Band nun übersetzt wurde, knapp fünfzig Jahre nach dem Erscheinen. Das ist eine Leistung, denn sprachlich ist er aller Knappheit zum Trotz weniger banal, als es scheinen mag. Die Übersetzer Paula Scholemann und Christoph Schmitz-Scholemann haben für schwierige Stellen meist überzeugende Lösungen gefunden und den lakonischen Tonfall getroffen. Fraglich ist allein die konsequente Kleinschreibung, die im Französischen keine Entsprechung hat; dort findet sich sogar Großschreibung an den Strophenanfängen, was die fehlenden Satzzeichen teils kompensiert. Die Possessivpronomina sind ein heikler Fall, denn das Französische lässt durch die Anpassung ans Objekt offen, ob sie ein männliches oder weibliches Subjekt meinen; die Übersetzung muss sich festlegen und wählt ein männliches Subjekt ("den Toten"). Darüber ließe sich diskutieren, wo ins Spiel gebracht wird, dass der Tote die "eigene Mutter" sein könnte.
Weniger wuchtig, aber berührender sind die Betrachtungen am Ende des Bandes: Sie beschreiben die Gesten des Überlebenden, der versucht, mit Tod und Trauer umzugehen. Abermals stehen konkrete Aspekte im Fokus: "man lässt ihn nicht / auf dem bett / die form / prägt sich zu stark ein / man muss auch an die denken / die sich später da reinlegen". Die Gedichte oszillieren zwischen Trauer und Verdrängung, zwischen dem fremden Körper und dem eigenen: "seine hände / auf allen gegenständen/ man muss warten / dass sie verschwinden / um den dingen / seinen eigenen schweiß zu geben". Es bleibt ein kleiner Trost: "wir werden reden können / worte verwesen nicht". NIKLAS BENDER
Jean-Louis Giovannoni: "Den Toten bewachen / Garder le mort".
Gedichte.
Aus dem Französischen von Paula Scholemann und Christoph Schmitz-Scholemann. Elsinor Verlag, Coesfeld 2021. 156 S., br., 16,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
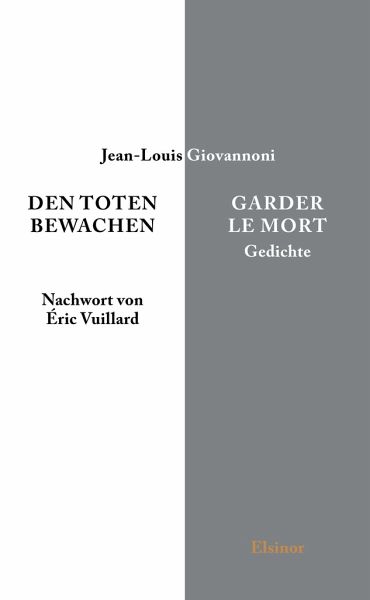




 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.06.2022
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 23.06.2022