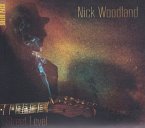Produktdetails
- Anzahl: 1 Audio CD
- Erscheinungstermin: 24. Februar 2017
- Hersteller: in-akustik GmbH & Co. KG / inakustik,
- EAN: 0707787914727
- Artikelnr.: 46873903
- Herstellerkennzeichnung
- in-akustik GmbH & Co. KG
- Untermatten 12 - 14
- 79282 Ballrechten-Dottingen
- service@in-akustik.de
| CD | |||
| 1 | Twelve String Mile | 00:04:09 | |
| 2 | Walk On Water | 00:04:22 | |
| 3 | Banjo Bam Bam | 00:03:37 | |
| 4 | Hands on Your Stomach | 00:04:02 | |
| 5 | Jump jelly belly | 00:03:56 | |
| 6 | Tripping On This | 00:03:16 | |
| 7 | D to E Blues | 00:03:30 | |
| 8 | Jump Out Of Line | 00:04:09 | |
| 9 | Just Want To Live With You Baby | 00:03:27 | |
| 10 | Roll Down The Hill | 00:04:05 | |
| 11 | Jump To Mexico | 00:04:19 | |