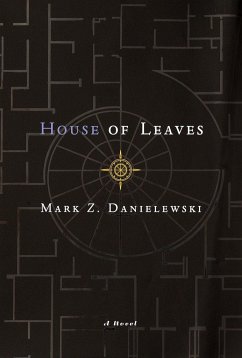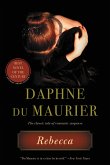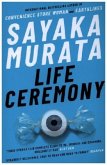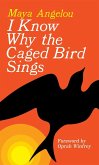One of the most acclaimed fiction debuts of 2000, national best-seller House of Leaves influenced, and was influenced by, the music of POE, Mark Z. Danielewski's sister. Her highly anticipated new album, Haunted, which includes many songs inspired by House of Leaves, will be released in September 2000 by Atlantic Records.
Years ago, when House of Leaves was first being passed around, it was nothing more than a badly bundled heap of paper, parts of which would occasionally surface on the Internet. No one could have anticipated the small but devoted following this terrifying story would soon command. Starting with an odd assortment of marginalized youth -- musicians, tattoo artists, programmers, strippers, environmentalists, and adrenaline junkies -- the book eventually made its way into the hands of older generations, who not only found themselves in those strangely arranged pages but also discovered a way back into the lives of their estranged children. Now, for the first time, this astonishing novel is made available in book form, complete with the original colored words, vertical footnotes, and newly added second and third appendices. The story remains unchanged, focusing on a young family that moves into a small home on Ash Tree Lane where they discover something is terribly wrong: their house is bigger on the inside than it is on the outside. Of course, neither Pulitzer Prize-winning photojournalist Will Navidson nor his companion Karen Green was prepared to face the consequences of that impossibility, until the day their two little children wandered off and their voices eerily began to return another story -- of creature darkness, of an ever-growing abyss behind a closet door, and of that unholy growl which soon enough would tear through their walls and consume all their dreams.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Years ago, when House of Leaves was first being passed around, it was nothing more than a badly bundled heap of paper, parts of which would occasionally surface on the Internet. No one could have anticipated the small but devoted following this terrifying story would soon command. Starting with an odd assortment of marginalized youth -- musicians, tattoo artists, programmers, strippers, environmentalists, and adrenaline junkies -- the book eventually made its way into the hands of older generations, who not only found themselves in those strangely arranged pages but also discovered a way back into the lives of their estranged children. Now, for the first time, this astonishing novel is made available in book form, complete with the original colored words, vertical footnotes, and newly added second and third appendices. The story remains unchanged, focusing on a young family that moves into a small home on Ash Tree Lane where they discover something is terribly wrong: their house is bigger on the inside than it is on the outside. Of course, neither Pulitzer Prize-winning photojournalist Will Navidson nor his companion Karen Green was prepared to face the consequences of that impossibility, until the day their two little children wandered off and their voices eerily began to return another story -- of creature darkness, of an ever-growing abyss behind a closet door, and of that unholy growl which soon enough would tear through their walls and consume all their dreams.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Mark Z. Danielewskis brillant verrätselter Roman
Wie lange ist es eigentlich her, daß sich die Washington Post, das Wall Street Journal und der Kulturteil des Rock- und Popfachblattes "Spin" auf denselben Roman als eine mittlere Sensation einigen konnten? Wann hat ein kommerziell erfolgreiches literarisches Debüt dem Autor zuletzt Vergleiche mit Melville und Nabokov eingebracht und wurde gleichzeitig von den Fans und Urhebern der neuen amerikanischen Popliteratur zwischen Douglas Coupland und Bret Easton Ellis geschätzt, ja geliebt? Und wann schließlich hat einer wie besagter Ellis je einen Konkurrenten mit den Worten gelobt, dessen Schöpfung sei ein "phänomenales Debüt" und "erhaben gespenstisch"?
Das alles widerfuhr einem 700 Seiten dicken, vor editorischen Arabesken schier berstenden Riesenromans namens "House of Leaves" von einem bislang unbekannten jungen Mann namens Mark Z. Danielewski, der sich so unversehens mit den genannten Größen, aber auch mit Thomas Pynchon, J.G. Ballard und William S. Burroughs in eine Reihe gestellt sieht.
Dabei ist die Grundidee seines ehrgeizigen Romanexperiments gar nicht sonderlich schwer darzustellen: "House of Leaves" gibt vor, der von einem fünfundzwanzigjährigen Angestellten eines Tätowierladens herausgegebene Nachlaß eines geheimnisvollen blinden alten Mannes zu sein, welcher seinen Lebensabend der Aufgabe gewidmet hat, eine luzide Studie über einen bizarren Dokumentarfilm namens "The Navidson Record" zu verfassen. Dieser Film handelt von einem Landhaus, das im Verlauf der Dreharbeiten so viele unvermutete, scheinbar "nachwachsende" Zimmer, Gänge und Irrgärten in seinem Innern offenbart, daß schließlich mehr als nur eine Person darin verlorengeht.
Den Haupttext des Buchs - eben besagte Film-Exegese - und die ausführlichen Fußnoten des Herausgebers Johnny Truant ergänzen Appendices, kurze Gedichte, Dokumente und Protokolle, außerdem Aufrißpläne des absurden Hauses, das dem Buch den Titel gab, sowie ein Index, der in manischer Detailversessenheit sogar auf Allerweltswörter wie "and" und "with" verweist.
Die Disparatheit des geschickt arrangierten Materials wird zusätzlich unterstrichen durch typographische Absonderlichkeiten wie halbleere Seiten, auf dem Kopf stehende oder gespiegelte Spalten, an lettristische Kunst erinnernde Buchstaben-Gitter, ein halbes Dutzend verschiedener Schrifttypen und mehr als einmal ein Satzbild, das an die unklassifizierbaren Exkursionen französischer Poststrukturalisten in para-literarische Bereiche denken läßt, etwa Jacques Derridas "Die Wahrheit in der Malerei".
Das Ergebnis dieses graphematischen Aufwands ist monströs und verunsichernd, oft aber auch bestrickend, mitreißend und gelegentlich witzig. Letzteres zeigt sich etwa, wenn Danielewski frech behauptet, Ausschnitte aus Interviews mit Prominenten des gegenwärtigen Pop- und Geisteslebens zu präsentieren, die sich selbstverständlich allesamt beeindruckt zum "Navidson Record" geäußert haben.
Den Tonfall seiner bekannten Masken trifft der Autor dabei meist traumhaft sicher: den Literaturtheoretiker Harold Bloom läßt er breit und schnurrig über Heideggers "Unheimliches" fantasieren, die Star-Intellektuelle Camille Paglia vermutet in der Geschichte des spukhaften Hauses "eine Manifestation des männlichen Vaginaneides" und der Horrorschriftsteller Stephen King findet den "Navidson Record" einfach "ganz schön gruslig".
Einer Legende zufolge hat Danielewski (von dem manche vermuten, es gebe ihn gar nicht, er sei lediglich das Pseudonym eines bekannteren Autors) sein "House of Leaves" zunächst in einer privat finanzierten Kleinstauflage kursieren lassen; erst die unerwartet große Resonanz habe ihn dann dazu verleitet, das Buch Verlagen anzubieten, von denen schließlich das traditionsreiche Unternehmen Random House den Zuschlag erhielt. Glücklicherweise, muß man sagen, denn ein noch so ambitionierter Kleinverlag hätte vermutlich gar nicht die Mittel aufbringen können, auch nur die typographisch-produktionstechnischen Probleme zu bewältigen, die "House of Leaves" mit sich bringt.
Unter den spielerischen Techniken literarischer Täuschung ist die editorische Mystifikation schon lange eine der reizvollsten. Ein Werk als Arbeit eines andern auszugeben erlaubt es Autoren, narrative Mehrdeutigkeit, Gebrochenheit und Verschachtelung zu betonen, das heißt: mit ihren Stoffen Dinge anzustellen, die zahllose Arten von Irritation, Kopfzerbrechen oder Bewunderung auslösen können.
Schon Cervantes und Rabelais haben diesen Kunstgriff angewendet, in der Moderne gab es dann kein Halten mehr: von Lautreamonts proto-surrealistischen "Gesängen des Maldoror" über Vladimir Nabokovs als Gedichtedition verkleideten Roman "Fahles Feuer" bis zu Italo Calvinos "Wenn ein Reisender in einer Winternacht" reicht das Spektrum der Werke, in denen das ebenso gelehrte wie gewitzte Spiel mit Vorworten, Randglossen, Fußnoten, Falltüren und falschen Ausgängen die jeweilige Fiktion um eine Fülle von Metafiktionen erweitert. Das eigentlich Bemerkenswerte an Danielewskis Buch ist weniger die Tatsache, daß da mal wieder eine jener besessenen Gestalten ein "unlesbares" und zugleich amüsantes Buch geschrieben hat. Womit niemand rechnen konnte, sind die verblüffend guten Verkaufszahlen der Random-House-Ausgabe. Dieser Coup verdankt sich wohl hauptsächlich dem Erfolg von "House of Leaves" bei den Popliteraten und ihren Fans. Die kalifornische Szene schenkt sich das Buch reihum zum Geburtstag; es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis dieser Ruhm auch auf Europa überschwappt.
Die Erfolgsgeschichte dieses ausgesprochen sperrigen Romans berührt ein Grundproblem des gegenwärtigen Erzählens überhaupt: die radikale Geste des emphatischen Verweises auf das "Jetzt" und der angestrengte Versuch, die Romanform vor der behaupteten Ödnis ausführlicher Schilderungen, psychologischer Erörterungen und steriler Seminar-Gelehrsamkeit zu retten.
Danielewskis Buch zeigt, daß neue, qualitativ von den bereits vorhandenen verschiedene Formen gar nicht nötig sind, um etwas Neues zu sagen. Das Spektrum seiner Stimmlagen und Erzähltechniken ist im Ergebnis sinnreiche Fülle statt hohler Prunk, solange die Spannung gehalten wird und der Angriff auf die Form "Story" diese nicht einfach negiert, sondern ihr an jeder neuen Front mit je eigenen Mitteln begegnet.
Daß der Autor dafür die Konstellation eines jungen, von Bildungsballast freien Herausgebers und "seines" uralten, im Schutt des eigenen Wissens grabenden Gelehrten wählt, macht den Dialog zwischen neuen Themen und alten Techniken zur Hauptsache, um die es in "House of Leaves" geht. Über den Augenblicksrummel hinaus wäre deshalb zu wünschen, daß die Existenz von Danielewskis Roman der Lagerbildung zwischen "altem" und "neuem" Erzählen entgegenwirkt.
So kann man nur hoffen, daß sich bald auch ein deutscher Verlag findet, der das mit einer Übersetzung verbundene Risiko eingehen will und kann. Danielewski selbst aber hat sich mit seiner Herkulestat eine Hypothek aufgeladen, um die ihn wohl niemand beneidet. Erstens hat er ein Buch geschrieben, das nicht ganz zu Unrecht allmählich im Verdacht steht, sowohl unlesbar zu sein wie auch inzwischen häufiger gekauft als gelesen zu werden. Zweitens aber sieht sich der Autor jetzt mit dem ewigen Problem von Popmusikern konfrontiert, die ein sensationelles erstes Album abgeliefert haben: Was, um Himmels willen, soll da noch kommen?
DIETMAR DATH
Mark Z. Danielewski: "House of Leaves". Roman. Pantheon/Random House, New York 2000. 709 S., geb., 40,- Dollar.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
House of Leaves has continued to reward readers prepared to navigate its labyrinth, with a community of fans ready to support them if they ever get lost in the dark. GUARDIAN