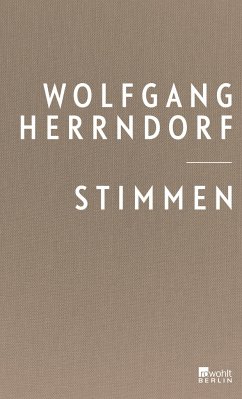Dass Unfertiges, Unvollendetes, gänzlich Unveröffentlichtes aus seinem Nachlass publiziert wird, wollte Wolfgang Herrndorf nicht. In seinem Testament verfügte er, solche Arbeiten seien zu vernichten. Daran haben die Erben sich gehalten. Es gibt aber eine Anzahl von Texten, die schon zu Herrndorfs Lebzeiten einen Weg in die Öffentlichkeit gefunden hatten, sei es abgedruckt an entlegenem Ort, sei es durch Lesungen, vor allem aber digital: Herrndorf war Mitglied des Internet-Forums "Wir höflichen Paparazzi", einem Verbund von Selbstdenkern und kreativen Menschen, aus dem inzwischen namhafte Autoren wie Kathrin Passig, Klaus Cäsar Zehrer oder Christian Y. Schmidt hervorgegangen sind. Das Forum war, so formuliert es Tex Rubinowitz, "eine beinharte stalinistische Schreibschule". Und alle, die dabei waren, sind sich einig: Am strengsten bei der Beurteilung eigener und fremder Texte war Wolfgang Herrndorf. Meist schrieb er unter dem Pseudonym "Stimmen".
Der vorliegende Band präsentiert eine Auswahl, Texte, die mal an "In Plüschgewittern" erinnern, mal an "Tschick", mal an die magischen Erinnerungsfragmente aus "Arbeit und Struktur". Es gibt u.a. eine Fahrt mit einem gestohlenen Schrottauto über Land, nur sind es keine Jugendlichen und das Auto ist kein Lada; Herrndorf selbst verirrt sich nachts mit dem Fahrrad im Wald und klingt wie Isa auf ihren Wanderungen im Mondschein. Nichts findet sich hier, das nur Dokument oder Autorenreliquie wäre; alles ist Literatur, auch das unvollendet Gebliebene, wo es vom Autor selbst in die Tradition des romantischen Fragments gestellt wird. Ein Schatz für Wolfgang Herrndorfs Leser.
Der vorliegende Band präsentiert eine Auswahl, Texte, die mal an "In Plüschgewittern" erinnern, mal an "Tschick", mal an die magischen Erinnerungsfragmente aus "Arbeit und Struktur". Es gibt u.a. eine Fahrt mit einem gestohlenen Schrottauto über Land, nur sind es keine Jugendlichen und das Auto ist kein Lada; Herrndorf selbst verirrt sich nachts mit dem Fahrrad im Wald und klingt wie Isa auf ihren Wanderungen im Mondschein. Nichts findet sich hier, das nur Dokument oder Autorenreliquie wäre; alles ist Literatur, auch das unvollendet Gebliebene, wo es vom Autor selbst in die Tradition des romantischen Fragments gestellt wird. Ein Schatz für Wolfgang Herrndorfs Leser.

Tiefsinn und Albernheit: Der Nachlassband „Stimmen. Texte, die bleiben sollen“ versammelt früh und
bei Gelegenheit veröffentlichte Erzählungen, Betrachtungen und Gedichte von Wolfgang Herrndorf
VON GUSTAV SEIBT
Wolfgang Herrndorf wollte nur Gelungenes hinterlassen. Als sein früher Tod absehbar wurde, hat er diesen Wunsch mit einer denkbar rigorosen Nachlasspolitik in die Tat umgesetzt. Auf Papier Erhaltenes wurde in Wasser eingeweicht und vernichtet, Dateien auf den Festplatten hat er planvoll gelöscht, über den erhaltenen Rest deutliche Verfügungen getroffen. Der letzte kleine Band, der jetzt erscheint, trägt die Rechtfertigung im Untertitel: „Texte, die bleiben sollten“. Er wurde in Absprache mit Herrndorfs Witwe von seinem Lektor Marcus Gärtner und seinem Freund Cornelius Reiber herausgegeben.
Der Haupttitel „Stimmen“ ist ein von Herrndorf selbst verwendeter Name der Feder auf der Internetplattform „Wir höflichen Paparazzi“, die das um die Jahrtausendwende so beliebte Schreiben in Gruppen mustergültig verwirklichte. Herrndorf, der in seinen Texten aus einzelgängerischen Gestimmtheiten kein Hehl machte, funktionierte offenbar gut in Freundeskreisen. Die „Paparazzi“ waren ein Ort, an dem wechselseitige Sympathie mit offenherziger Kritik zusammenging. Die große elektronische Weltmaschine enthält eben auch Zimmer und Wohngemeinschaften. Die jetzt gesammelten Texte vermitteln etwas von diesem Geist, einer unangestrengten Konzentriertheit.
„Stimmen“ enthält keine Anfängerarbeiten, nichts Unfertiges oder bloß Probiertes. Keines der abgedruckten Stücke – kurze Erinnerungen, Erzählungen, Betrachtungen, ein paar Gedichte – ist vor 2001 entstanden. Da saß Herrndorf schon an seinem ersten Roman „In Plüschgewittern“, der 2002 herauskam und einen fertigen Künstler zeigte. Übrigens hat Herrndorf ihn für die Taschenbuchausgabe 2012 noch einmal gründlich überarbeitet. Die Literaturwissenschaft sollte die Chance nutzen und durch einen detaillierten Vergleich der beiden Fassungen dem skrupulösen Handwerker Herrndorf auf die Spur kommen.
Denn es ist nicht ganz leicht, seinen Stil zu charakterisieren. Er ist unfeierlich, ja, und gleichzeitig von unverkennbarer Poesie. Er hält sich vom aufdringlichen Casual ebenso fern wie von sichtbarer Gewähltheit, gar einer Manier, also allem Gebosselten oder Atelierhaften. Sein Erzählen bezieht sich auf heutige Lebensumstände, aber schon am nächsten Absatz wird sein Realitätsstatus fraglich. Trotzdem gleißt hier kein magischer Realismus oder andere Scheußlichkeiten.
Der Vergleich mit dem gegenständlichen Maler, der Herrndorf auch war, führt in die Irre. So deutlich er schreibt: Er schwelgt nicht in üppigen Anschaulichkeiten. Es ist bekannt, dass er Stendhal schätzte. Voilà, Stendhal und nicht seine mit Anschauung und Details überfüllten Nachfolger. Dass man diesen Stil erst einmal im Ausschlussverfahren beschreiben kann, sagt viel über Herrndorfs Können, die Unaufdringlichkeit seiner Meisterschaft.
Die besten Texte des neuen Bändchens stehen gleich am Anfang, es sind Kindheitserinnerungen (alle Menschen schreiben das Beste immer über ihre Kindheit). Die allerbeste Stelle hat der Verlag auf die Rückseite gedruckt. Herrndorf hat sich beim Spielen mit einem Puppenstubenherd einen Finger verbrannt. Er versucht, die Verletzung zu verbergen, muss zugleich mit Entsetzen feststellen, dass der Schmerz erst einmal bleibt. „Gebranntes Kind scheut das Feuer“, heißt es im Sprichwort. Herrndorf berichtet von einem anderen Lernprozess: Der Schmerz, der über Stunden nicht nachlässt, könnte ihn fortan das ganze Leben begleiten, zum Schicksal werden. So sieht Kinderschrecken aus. Später erfährt er, dass auch die Freundin, mit er zusammen spielte, sich verbrannt und versucht hatte, das Missgeschick zu verstecken. So sieht Kindereinsamkeit aus. Aus der angedachten Heirat der beiden Kinder wurde dann doch nichts.
In der Sammlung stehen zwei, drei Erzählungen, die als Vorläufer der Fahrt ins Blaue in Herrndorfs Meisterwerk „Tschick“ gelten können. Es geht im Hier und Jetzt los, und am Ende ist man über enharmonische Realitätsverrückungen in einem Traumgebiet angelangt oder einfach im Wald verirrt. Nahtstellen: keine. Auch hier ist es also die Abwesenheit von etwas – der Sichtbarkeit von Konstruktion –, die das Außerordentliche darstellt. Auch eine klassische Short Story gibt es: Der Ich-Erzähler trifft an einer Haltestelle auf eine demente Frau und will ihr helfen. Dabei bekommt er Konkurrenz von einem verdächtigten Türken. Will der sie nur beklauen? Erst der letzte Satz enthüllt die Pointe.
Pointen haben diese Texte oft, aber meist verdeckte. Ein Treffen mit einem schönen Mädchen, erotisch aufgeladen, versandet – warum? Vielleicht nur an der Hässlichkeit der Umwelt vor der Sitzbank, auf der die fast, aber noch nicht ganz Verliebten sich niedergelassen haben.
Es gehört zum Genre „Kurzer Text“, aufs Verwunderliche, Rätselhafte oder auch nur Komische zu zielen. Man liest das mit großem Vergnügen, oft mit Gelächter. Das Moment von Überraschung und Absonderlichkeit, das sie ansteuern, verbietet Referate.
Die nicht sehr zahlreichen Gedichte sind – darüber lässt sich nicht hinwegsehen – das Entbehrlichste der Sammlung, es sind Reimereien mit konventionellen Motiven, die sich eben reimen und nicht viel mehr. So kann man dreimal ins Klavier greifen und „Musik“ spielen. Sie spielen mit dem Instrument und beweisen, dass es klingt. Es ist längst nicht mehr kühn, auch auf klassische Strophenformen zurückzugreifen. Wenn hier Robert Gernhardt winkt, dann winkt er sehr von ferne.
„Akalkulie“, was man mit „Missverhältnis zu Zahlen“ übersetzen könnte, heißt ein Dramolett, das nach dem Muster von Spielshows im Fernsehen aufgebaut ist. Der Kandidat kann zwischen drei Türen wählen, hinter zweien steht je eine Ziege, hinter der dritten „der Sensenmann“. Auch eine Million spielt eine Rolle. Der wiedererkennbare Quatsch wird zum theologischen Denkspiel, das bis zur Trinität ausgreift, in einer prekären Mischung von Albernheit und Tiefsinn. Auch hier dieses Herrndorf’sche Gleiten vom realen Ausgangspunkt zu Traum und Irrgarten.
Ein ganz kurzes Stück argumentiert, dass manche Verschwörungstheorien den Kriterien von „Ockhams Rasiermesser“ genügen, also der Anforderung, dass Erklärungen möglichst einfach und sparsam mit Zusatzhypothesen sein sollten: Bei der „Mondlandungslüge“ erfordere die Erklärung „Filmstudio“ sehr viel weniger Hilfshypothesen „als zu sagen, die sind wirklich mit hochkomplizierten Maschinen da nach oben geflogen“ – um dann noch in Klammern anzufügen, das sei ein falscher Begriff von Einfachheit. Wenn es einen Schlüssel zu Herrndorfs Gleiten oder auch seiner Freude an Kippfiguren gibt, dann könnte er in solchen Überlegungen liegen: der Romantiker als Intelligenzbestie.
Aber programmatisch war bei ihm nur die Absage ans Programmatische. Kurz und ablehnend reagierte er auf Manifeste der Nullerjahre, die heute schon vergessen sind. Sein Verhältnis zur Tradition ist völlig frei: Dass der Humor von Laurence Sterne bei ihm nicht funktionierte, konstatierte er mit wuchtiger Plausibilität, da half der ganze Ruhm nicht.
Selbst an seinen wuchtigsten Einzelsatz konnte er sich nicht halten: „Wenn ich jemals etwas anderes als reine Fiktion schreiben sollte, erschießen Sie mich bitte.“
So deutlich er schreibt:
Er schwelgt nicht in
üppigen Anschaulichkeiten
Der wiedererkennbare
Quatsch wird zum
theologischen Denkspiel
Lange vor dem Erfolg seines Romans „Tschick“ schrieb Wolfgang Herrndorf zum Teil unter Pseudonym die Texte, die jetzt gesammelt erscheinen. Er starb 2013 nach schwerer Krankheit.
Foto: Patrick Seeger / DPA
Wolfgang Herrndorf:
Stimmen. Texte, die bleiben sollten. Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2018.
192 Seiten, 18 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Schmerzlich wird Ulrich Seidler mit diesen aus dem Nachlass des Autors veröffentlichten Texten an den Tod Wolfgang Herrndorfs erinnert. Allerdings auch daran, dass die Blogeinträge ja nicht unveröffentlicht sind, sondern aus "Wir höflichen Paparazzi" stammen. Die Entscheidung der Herausgeber Marcus Grätner und Cornelius Reiber zur Veröffentlichung in Buchform, ahnt er, war nicht einfach. Herausgekommen ist laut Rezensent ein Sammelsurium aus Wortspielartigem, Lyrischem, durchaus Manieriertem, Glossen und Satiren. Dass Herrndorf recht intolerant über Kunst und Literatur urteilen konnte, erfährt Seidler hier auch. Die Begegnung mit einem oft einsamen, wütenden und zynischen Erzähler, findet er. Herrndorfs Kindheitserinnerungen gefallen ihm noch am besten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Herrndorfs Poesie ist pur und direkt, unendlich traurig und berückend schön. Die Zeit