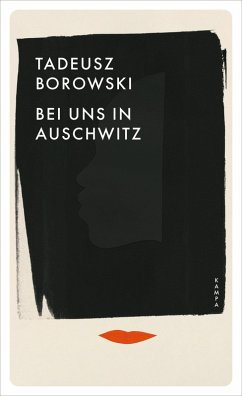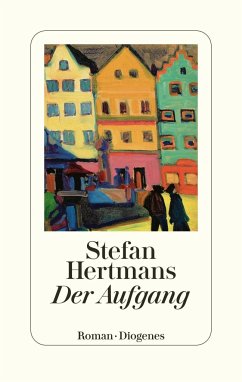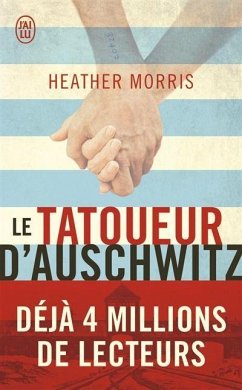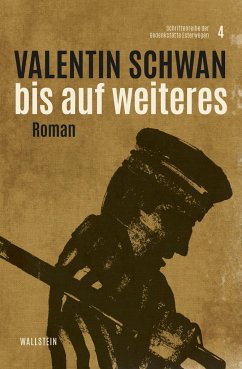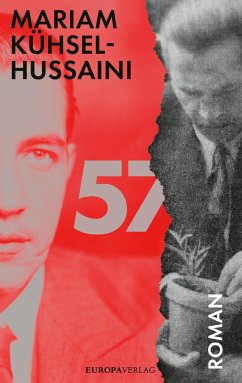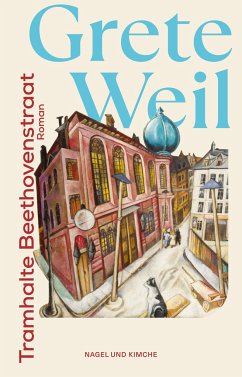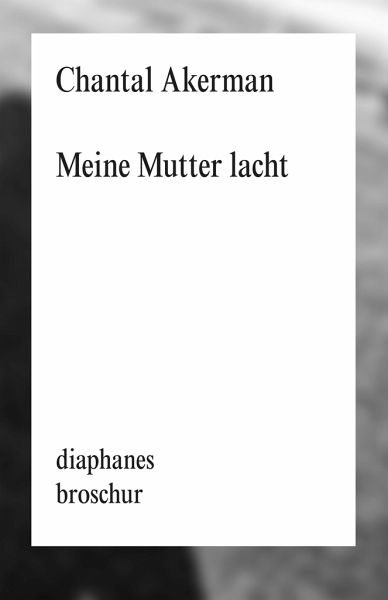
Meine Mutter lacht

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Zeit ihres Lebens vermag die Mutter nichts zu erzählen von ihrem Leid in Auschwitz, während sich die Tochter ihre ganz eigene filmische und künstlerische Sprache erarbeitet, ein Leben in Paris und New York sucht und findet. Als die Mutter schließlich gebrechlich ist, protokolliert sie die ihnen gemeinsam verbleibende Zeit. Im wiederkehrenden Lachen der Mutter, dem Rhythmus der Tage und Nächte erinnert sich die Tochter an ihr eigenes Leben, blickt auf entscheidende Freundschaften und Liebschaften zurück.Meine Mutter lacht changiert zwischen nüchternem Journal und zärtlicher Anrede, frag...
Zeit ihres Lebens vermag die Mutter nichts zu erzählen von ihrem Leid in Auschwitz, während sich die Tochter ihre ganz eigene filmische und künstlerische Sprache erarbeitet, ein Leben in Paris und New York sucht und findet. Als die Mutter schließlich gebrechlich ist, protokolliert sie die ihnen gemeinsam verbleibende Zeit. Im wiederkehrenden Lachen der Mutter, dem Rhythmus der Tage und Nächte erinnert sich die Tochter an ihr eigenes Leben, blickt auf entscheidende Freundschaften und Liebschaften zurück.
Meine Mutter lacht changiert zwischen nüchternem Journal und zärtlicher Anrede, fragiler Auseinandersetzung und intimem Selbstgespräch und ist das schmerzhafte Zeugnis mehrerer Abschiede: ein Schlüssel zum Werk der großen Filmemacherin und ein ergreifendes Stück autobiographischer Literatur.
Meine Mutter lacht changiert zwischen nüchternem Journal und zärtlicher Anrede, fragiler Auseinandersetzung und intimem Selbstgespräch und ist das schmerzhafte Zeugnis mehrerer Abschiede: ein Schlüssel zum Werk der großen Filmemacherin und ein ergreifendes Stück autobiographischer Literatur.