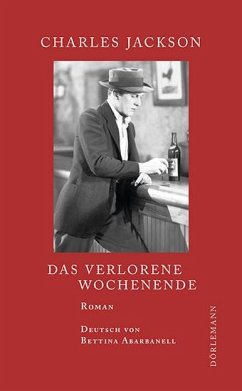Manhattan 1936, East Side. Don Birnam trinkt. Und der Schriftsteller hat längst jenen Punkt erreicht, an dem »ein Drink zu viel ist und hundert nicht genügen«. Seit dem letzten Absturz kaum wieder auf den Beinen, widersetzt er sich erfolgreich allen Versuchen seines Bruders Wick, ihn zu einem langen Wochenende auf dem Land zu überreden, und bleibt fünf Tage in der gemeinsamen Wohnung allein. Dort nimmt das Schicksal seinen Lauf: Don trinkt, beschafft sich Geld, verliert es, besorgt sich neues, landet auf der Alkoholstation, trinkt weiter. Schwankend zwischen Euphorie und Verzweiflung, Selbsterkenntnis und Selbsttäuschung, Inspiration und Panik, glasklarem Denken und tiefer Umnachtung, fällt Don zunehmend ins Delirium.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Thomas David ist heilfroh um dieses Buch. Muss er doch all den Scotch nicht selber trinken, den der Held in Charles Jacksons 70 Jahre altem Roman in sich hineinschüttet. Das Delirium eines Säufers am Ende seiner Zeit hat ihm der Autor mit diesem Buch, seinem größten Erfolg, derart genau und mit all seinen Selbstüberschätzungen und Abstürzen vor Augen geführt, dass ihm die Lektüre genügt. Erschreckend scheint David dieser Höllentrip aber auch, da er die Parallelen zwischen dem Helden und Jacksons Biografie deutlich erkennen kann. Für den Rezensenten im doppelten Sinn der Roman eines Lebens.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Berühmt, verfilmt, verkatert: Der kurze Ruhm von Charles Jackson und seinem Trinkerroman "Das verlorene Wochenende"
Lüge, Betrug und Verrat, die blutigen, vom Glanz einer Messerklinge heraufbeschworenen Phantasien. Ekel und Scham, die Schuld, das Verderben, das von zerstörerischen Leidenschaften berauschte Herz, das in diesem irritierenden, auch siebzig Jahre nach seiner Erstveröffentlichung noch immer lesenswerten Roman einem schmutzigen Ende entgegenschlägt. In "Das verlorene Wochenende" gießt der 1968 gestorbene amerikanische Schriftsteller Charles Jackson die Qual und den ganzen Jammer der menschlichen Existenz in ein leeres Whiskyglas und lässt den Leser im Dunst und Delirium mehrerer Tage mit seinem vor brennendem Lebensdurst vergehenden Protagonisten Don Birnam allein.
Oktober im New York des Jahres 1936: "Das Barometer seiner Gefühlsnatur zeigte eine Unwetterperiode an", wie es in dem Zitat aus Joyces "Dubliner" heißt, dem ersten Satz von Jacksons Roman, in dem der Autor keine Zeit verschwendet und störende Nebenfiguren wie Dons Freundin Helen und dessen jüngeren Bruder Wick ohne Umschweife bis auf weiteres hinauskomplimentiert. Jackson erzählt, wie Don die beiden versetzt hat, um das gemeinsam mit seinem Bruder bewohnte Apartment an der East Side von Manhattan ein paar Tage für sich allein zu haben. Er erzählt, wie Don das für die Putzfrau bereitgelegte Geld einsteckt, im Bad noch schnell die Krawatte zurechtzieht und hinunter auf die 55. Straße geht, um in der nächstbesten Bar seinen Absturz einzuleiten.
Don ist dreiunddreißig Jahre alt, ein sensibler, seit Ende des Studiums traumverloren durchs Leben taumelnder Quartalssäufer, der sich nach einer Zeit der Dürre abermals auf die vorhersehbaren Bahnen einer "Talfahrt bis zum letzten Stadium der Gefahr" begibt. Als er im dunklen Spiegel über der Bar sein Gesicht betrachtet, die tiefliegenden Augen, den Schnurrbart, den tragischen Ausdruck, ist er fasziniert von seiner Ähnlichkeit mit Edgar Allan Poe.
Die vermeintliche Seelenverwandtschaft mit dem im Delirium gestorbenen Dichter und der anfängliche, den Sturm im Whiskyglas entfesselnde Satz aus "Dubliner", den Don nicht nur mit der Überzeugung liest, dass darin von ihm die Rede ist, sondern auch mit dem Wahn, "er hätte ihn selbst geschrieben haben können", dazu Zitate und zahllose literarische Anspielungen sowie Dons vom Autor etwas breitgewalzte Schwärmerei für Greta Garbo, die 1936 in George Cukors "Die Kameliendame" einen ihrer größten Erfolge feierte: im abnehmenden Licht des Sonnenuntergangs vor Dons erschreckender Reise in die Nacht schildert Charles Jackson auch den narzisstischen Höhenflug der im Aufwind eines Größenwahns dahintreibenden Träume vom eigenen Ruhm. Es sind Gespenster seiner ungeschriebenen Romane, die Don im Zwielicht des Bewusstseins mitreißen und sich immer wieder in Ekel angesichts der eigenen Nichtigkeit auflösen, in das triefende Selbstmitleid, das hochprozentiger ist als der Whisky, mit dem er letztlich auch die demütigende Erkenntnis der eigenen Talentlosigkeit hinunterzuspülen versucht.
"Ein Wort noch", so Don, bevor er seine in teures Leder gebundene Ausgabe von "Der große Gatsby" zurück ins Regal stellt und die in seinem Apartment herbeiphantasierten Studenten im Zustand der Selbsterniedrigung wieder aus den Augen verliert: "Fitzgerald weicht nie auch nur um Haaresbreite von jener Regel ab, welcher jeder sein Geld werte Schriftsteller folgen wird: Schreibe nie über etwas, wovon du nichts verstehst."
So gern er sich auch in der Gegenwart von Genie und Größe wähnt, im Spiegel dieses Satzes blickt Don direkt ins Antlitz seines Autors Charles Jackson, dessen Name im Sommer 1942, als er mit der Arbeit an "Das verlorene Wochenende" begann, allenfalls den Hörern der täglichen Radio-Soap "Sweet River" vertraut war. Der 1903 geborene Jackson konzipierte seinen ersten Roman nicht nur als Hommage an den 1940 verstorbenen F. Scott Fitzgerald, er beherzigte auch den im Buch zitierten Rat dieses Idols und belebte Don Birnams Geschichte mit den Erinnerungen an das Martyrium seiner eigenen, Ende der dreißiger Jahre vorübergehend überwundenen Alkoholsucht.
Der Schriftsteller war mit Erscheinen des Romans über Nacht berühmt geworden, im Schatten von Billy Wilders 1945 entstandener Verfilmung aber allmählich wieder in Vergessenheit geraten. Jacksons Biograph Blake Bailey weist in seiner 2013 erschienenen Biographie eine derartige Fülle von Übereinstimmungen zwischen Figur und Autor nach, dass Jacksons Buch auch in dieser Hinsicht getrost als der Roman seines Lebens gelesen werden darf.
Jackson lässt seine Figur in derselben Straße wohnen, in der er selbst sich Mitte der dreißiger Jahre mit seinem jüngeren Bruder ein Apartment geteilt hatte. Er quält Don Birnam mit den gleichen Träumen von Reichtum und literarischem Ruhm, die auch ihn von Kindheit an geplagt hatten, mit dem tiefen Gefühl der Einsamkeit, dem sentimentalen Gift der Erinnerungen, und er erzählt in einem der eindringlichsten Kapitel von "Das verlorene Wochenende", wie er seine Schreibmaschine an Jom Kippur auf der Suche nach einem geöffneten jüdischen Leihhaus kilometerweit bis hinauf zur 120. Straße schleppte und unter ihrem Gewicht schließlich fast zusammenbrach.
"Wie wenig die Menschen wussten! Wie wenig sie wussten oder verstanden", so Jackson in dem Roman, in dem er den Leser auf beängstigende und geradezu intime Weise in die lange Spirale einer Zerstörung zieht, an deren Ende sich der Autor ein Vierteljahrhundert nach Veröffentlichung seines einzigen nennenswerten Erfolgs das Leben nahm. "Wie könnten sie es je verstehen! Woher sollten die Leute - alle! - die Passanten auf der Straße - die beiden Damen, die in der vorderen Wohnung ihr Mittagessen kochten - die ahnungslosen unschuldigen Passagiere des L-Zugs einen halben Häuserblock weiter -, woher sollten sie wissen, welche Hölle in diesem Zimmer los war!" Dank Jacksons grandiosem, von Bettina Abarbanell neu übersetztem Roman brauchen wir keine Flasche Scotch, um diese Hölle zu betreten.
THOMAS DAVID
Charles Jackson: "Das verlorene Wochenende". Roman.
Aus dem Amerikanischen von Bettina Abarbanell. Mit einem Nachwort von Rainer Moritz. Dörlemann Verlag, Zürich 2014. 352 S., geb. 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Eine wirkliche Wiederentdeckung« Ulrich Rüdenauer / Süddeutsche Zeitung
»Dank Jacksons grandiosem, von Bettina Abarbanell neu Übersetztem Roman brauchen wir keine Flasche Scotch, um diese Hölle zu betreten.« Thomas David / Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Bettina Abarbanell hat mit ihrer kongenialen Übersetzung zu einem Leseerlebnis beigetragen, das man so noch nie hatte: der Erfahrung - so seltsam es klingt -, wie literarisch vollkommen und analytisch brillant ein Trinkerroman sein kann.« Bernadette Conrad / Neue Zürcher Zeitung
»Ein Mann, der durch sein Leben stolpert ... und der durch das Schneegestöber der Wirklichkeit hindurch nicht mehr weiter sieht als bis zu seiner Hand, die gerade noch ein Glas Wiskey zu halten vermag.« Ulrich Rüdenauer / SWR2
»Charles Jacksons Roman ist dehalb so faszinierend wie bestürzend, weil er ganz akribisch protokolliert, was im Kopf eines Menschen passiert, der wirklich um die eigene Sucht weiß.« Gesa Ufer / rbb
»Dank Jacksons grandiosem, von Bettina Abarbanell neu Übersetztem Roman brauchen wir keine Flasche Scotch, um diese Hölle zu betreten.« Thomas David / Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Bettina Abarbanell hat mit ihrer kongenialen Übersetzung zu einem Leseerlebnis beigetragen, das man so noch nie hatte: der Erfahrung - so seltsam es klingt -, wie literarisch vollkommen und analytisch brillant ein Trinkerroman sein kann.« Bernadette Conrad / Neue Zürcher Zeitung
»Ein Mann, der durch sein Leben stolpert ... und der durch das Schneegestöber der Wirklichkeit hindurch nicht mehr weiter sieht als bis zu seiner Hand, die gerade noch ein Glas Wiskey zu halten vermag.« Ulrich Rüdenauer / SWR2
»Charles Jacksons Roman ist dehalb so faszinierend wie bestürzend, weil er ganz akribisch protokolliert, was im Kopf eines Menschen passiert, der wirklich um die eigene Sucht weiß.« Gesa Ufer / rbb