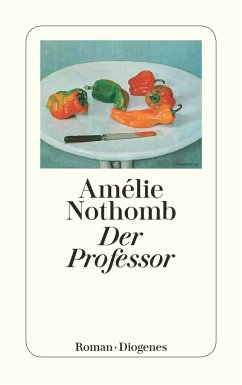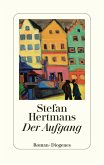Nur für Andächtige: Amélie Nothomb erzählt vom Rentenalter
In Amélie Nothombs Roman "Der Professor" schwärmt der Altphilologe Emile Hazel von Ruhestand und Lebensabend. Endlich lebt er mit seiner Frau auf dem Land, in tiefer Stille, friedvoll und erfreulich abgeschieden, von größtmöglicher Naturschönheit umgeben. Jetzt kann er seinen Garten kultivieren und die Zeit, die ihm noch bleibt, genießen. Die weiße Magie des Glücks im Winkel durchkreuzt jedoch der einzige Nachbar mit der schwarzen seiner Misanthropie. Er dringt in die Idylle ein und macht sich darin breit, ein maulfauler Quälgeist, der regelmäßig bewirtet zu werden wünscht. Bei den verschiedenen, zunächst schlichten, dann listigen und schließlich rabiaten Versuchen, sich des Störenfrieds zu entledigen, verwandelt sich sein unfreiwilliger Gastgeber von einem harmlosen alten Ehemann in einen Verbrecher.
Und er stückelt sich eine tief und bedenklich hohl klingende Privatphilosophie zurecht. "Als ich vor zwölf Monaten in dieses Haus gezogen bin, wußte ich, wer ich war: irgendein Griechisch- und Lateinlehrer, dessen Leben keine Spur hinterlassen wird. Jetzt blicke ich in den Schnee hinaus. Auch er wird keine Spur hinterlassen, wenn er geschmolzen ist. Aber nun verstehe ich, er ist ein Geheimnis." Dieses Geheimnis ist banal. Wo der Prosazauber seine größte Intensität erreichen soll, kehrt Geschwätzigkeit ein.
Der Ich-Erzähler ist ein Mittsechziger, und die Autorin ist fast vierzig Jahre jünger, aber sie beschreibt die Wonnen und die Schrecken des Alters klarer, als man sie aus den Memoiren Achtzigjähriger zu kennen glaubt. Bei der Schilderung des innigen, noch unversehrten Eheglücks bewegt sie sich hart an der Grenze zur Rührseligkeit, und die Introspektion, der sich Emile Hazel unterzieht, um in seinem Gedächtnis ein Krisenrezept zu finden, bringt Kindheitserinnerungen ans Licht, deren Trivialität auf der Hand liegt. Dem Roman bekommt es nicht gut, wenn er anders als andächtig gelesen wird. Dann schmilzt der Zauber dahin, ohne eine Spur zu hinterlassen, und es bleibt auch kein Geheimnis übrig.
Dafür werden die komischen Möglichkeiten der Geschichte um so besser ausgereizt. Um den täglich zwei Stunden lang sauertöpfisch im Wohnzimmer verharrenden Gast zu vergraulen, versucht sich Emile Hazel "in der Rolle des Anöders" und bemüht sich, ausschweifend über möglichst uninteressante Themen zu dozieren: "Wenn ich meiner Klasse einen lebhaften Eindruck von Cicero zu geben versuchte, kam es vor, daß ich innerlich ein Gähnen unterdrücken mußte. Wenn ich dagegen unseren Quälgeist mit unverdaulichen Brocken meiner Gelehrsamkeit überhäufte, konnte ich nicht umhin zu frohlocken." Jovial und gesprächig erscheint der hartnäckige Nachbar erst im Vergleich mit seiner Frau Bernadette, einer "Protuberanz" aus Fett und Fleisch, die von ihrem Mann nach Möglichkeit unter Verschluß gehalten wird.
Amélie Nothomb ist eine Unterhaltungsschriftstellerin, die flüssig erzählt und auch Überflüssiges erzählt. Zielt sie auf Andacht ab, rutschen ihr Weisheiten heraus, die auch nicht tiefgründiger sind als die Trockeneisnebel von Avalon: "Wahrer Edelmut ist der, den niemand verstehen kann. Sobald das Gute bewundert wird, ist es nicht mehr gut." Wo sie sich solche Sentenzen spart und bei der Sache bleibt, steigt die Spannung deutlich an, und es gibt keinen Grund, sich ihr zu entziehen.
Der Verlag bewirbt den Roman als "Psychothriller", eine Bezeichnung, die er nicht verdient hat. Der Thrill ist nebensächlich, wenn das Ehepaar Hazel sich der schwachsinnigen Bernadette erbarmt, sie zu einem Picknick entführt und sich bemüht, sie der Aufsicht ihres Mannes zu entziehen.
Voraussichtlich wird aber auch dieser Roman in der Kritik dem Jargon nicht entkommen, auf den sich die Rezensenten, was Amélie Nothomb betrifft, geeinigt haben. Ihre Bücher, steht zu lesen, seien frivol, makaber, brillant, herrlich böse, spitzzüngig, komisch und frech, jung und genial und voller Esprit. Das vergnüglich Zynische und das herrlich Böse, ermüdend oft bemüht, wirken wie Stempelkissen mit Kniff.
Unentbehrlich scheint auch der Verweis auf Nothombs exotische Jugend zu sein, die sie als Tochter eines belgischen Diplomaten in Tokio und Peking, Burma, Bangladesh und Laos verbrachte, "wie eine dieser romantischen Figuren von Maguerite Duras" ("Der Spiegel"). Dem Züricher"Magazin" ist es sogar gelungen, Nothomb selbst auf dieses Niveau hinabzuziehen und ihr das schale Zitat zu entlocken, daß das Schreiben für sie "eine Droge" sei ("Ich empfinde dabei allerhöchste Glücksgefühle, gleichzeitig ist es ein dringendes Bedürfnis, das ich unter allen Umständen stillen muß"). Das wollte nun wirklich niemand wissen. GERHARD HENSCHEL
Amélie Nothomb: "Der Professor". Roman. Aus dem Französischen übersetzt von Wolfgang Krege. Diogenes Verlag, Zürich 1996. 196 S., geb., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Amélie Nothomb ist eine Meisterin darin, die dunklen Seiten des Menschen aufzuzeichnen, die Wunden, die wir einander zufügen.« Kronen Zeitung Kronen Zeitung