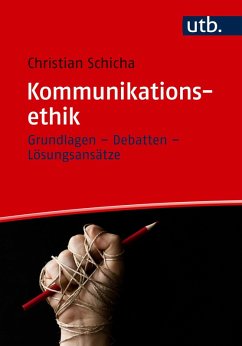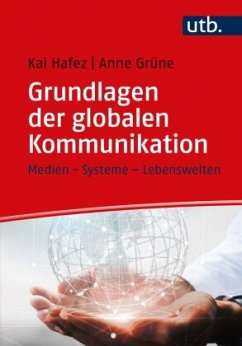Das Diktat des Hashtags
Über ein Prinzip der aktuellen Debattenbildung

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Öffentliche Debatten werden heutzutage per Hashtag geführt. Mit seiner Hilfe werden die Beiträge gebündelt und zugeordnet: Alles muss sich auf ein gemeinsames Schlagwort konzentrieren. Dieses Prinzip sorgt für eine stärkere Sichtbarkeit und Orientierung kollektiver Argumente, hat aber auch eine riskante und manchmal fragwürdige Konsequenz. Denn der Hashtag verstärkt formal genau das, was inhaltlich kritisiert wird: Differenzen verschwimmen und Unterschiedliches wird zu Gleichem. Zuletzt hat die #MeToo-Debatte dieses Problem sichtbar gemacht. In seiner pointierten Darstellung zeichnet A...
Öffentliche Debatten werden heutzutage per Hashtag geführt. Mit seiner Hilfe werden die Beiträge gebündelt und zugeordnet: Alles muss sich auf ein gemeinsames Schlagwort konzentrieren. Dieses Prinzip sorgt für eine stärkere Sichtbarkeit und Orientierung kollektiver Argumente, hat aber auch eine riskante und manchmal fragwürdige Konsequenz. Denn der Hashtag verstärkt formal genau das, was inhaltlich kritisiert wird: Differenzen verschwimmen und Unterschiedliches wird zu Gleichem. Zuletzt hat die #MeToo-Debatte dieses Problem sichtbar gemacht. In seiner pointierten Darstellung zeichnet Andreas Bernard die steile Karriere des Hashtags nach und zeigt überzeugend, wie unsere aktuellen Debatten durch ein Prinzip strukturiert werden, das so beiläufig wie mächtig geworden ist. Wer unsere öffentliche Diskussionskultur verstehen will, kommt an diesem Buch nicht vorbei.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.