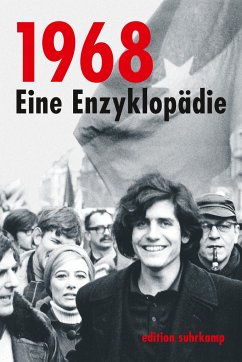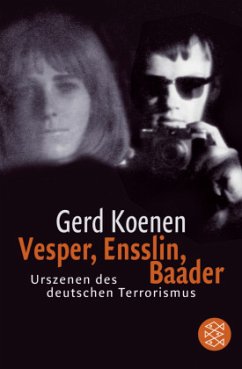Notstandsgesetze von Deiner Hand
Briefe 1968/69
Herausgegeben: Harmsen, Caroline; Seyer, Ulrike; Ullmaier, Johannes;Mitarbeit: Ensslin, Felix
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
18,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Anfang 1968, Gudrun Ensslin verläßt Bernward Vesper und zieht mit ihrem sieben Monate alten Sohn Felix zu Andreas Baader. Bald darauf brennen in Frankfurt zwei Kaufhäuser; Baader, Ensslin und Thorwald Proll werden als mutmaßliche Brandstifter verhaftet, Felix ist bei Vesper, die Geschichte der RAF nimmt ihren Lauf.In keinem anderen Dokument kommt man ihrer Entstehung so nah, wie in den hier erstmals vollständig veröffentlichten Briefen, die Vesper und Ensslin bis zu ihrer bedingten Freilassung und Flucht Mitte 1969 gewechselt haben. Nach allen Glorifizierungen und Pathologisierungen, Verflimungen und Deutungen besteht nun die Möglichkeit, sich am Original ein eigenes Urteil zu bilden, Epochales und Banales, Mythos und Historie unvoreingenommen zu sondieren und einen großen, tragischen Liebes-Brief-Roman zu entdecken, der zugleich Realität war. Nicht umsonst steht auf der Mappe, in der Vesper die Briefe gesammelt hat: "Notstandsgesetze von Deiner Hand".