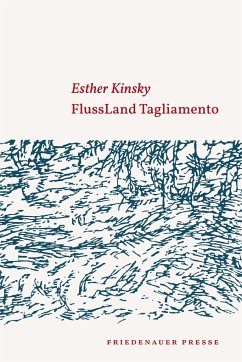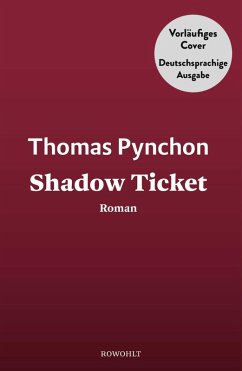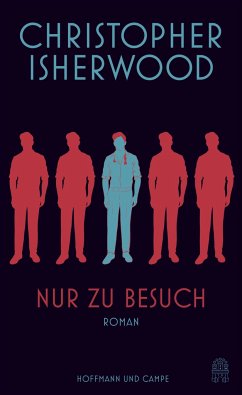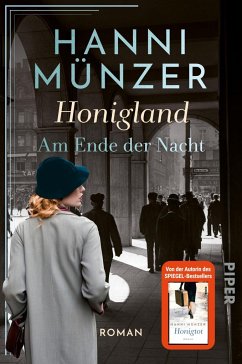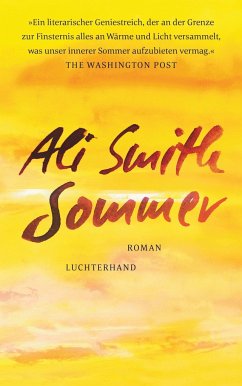Weiter Sehen
Von der unwiderstehlichen Magie des Kinos

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Auf einer Reise durch den Südosten Ungarns macht die Erzählerin in einem fast ausgestorbenen Ort an der Grenze zu Rumänien Station. Resignation und Vergangenheitsglorifizierung beherrschen die Gespräche der Bewohner. Wie vieles andere ist auch das Kino, ungarisch »Mozi«, längst geschlossen. Einst Mittelpunkt des Ortes, spielt es nur mehr in den Erzählungen und Erinnerungen der Verbliebenen eine wichtige Rolle. Ihre eigene Leidenschaft für das Kino bewegt die Erzählerin dazu, das vor sich hin verfallende »Mozi« wieder zum Leben zu erwecken.In ihrem neuen Buch erzählt Esther Kinsky ...
Auf einer Reise durch den Südosten Ungarns macht die Erzählerin in einem fast ausgestorbenen Ort an der Grenze zu Rumänien Station. Resignation und Vergangenheitsglorifizierung beherrschen die Gespräche der Bewohner. Wie vieles andere ist auch das Kino, ungarisch »Mozi«, längst geschlossen. Einst Mittelpunkt des Ortes, spielt es nur mehr in den Erzählungen und Erinnerungen der Verbliebenen eine wichtige Rolle. Ihre eigene Leidenschaft für das Kino bewegt die Erzählerin dazu, das vor sich hin verfallende »Mozi« wieder zum Leben zu erwecken.
In ihrem neuen Buch erzählt Esther Kinsky von der unwiderstehlichen Magie des Kinos, eines Ortes, »wo Witz, Entsetzen und Erleichterung ihren gemeinschaftlichen Ausdruck fanden, ohne dass die Anonymität im dunklen Raum angegriffen wurde«. Aller glühenden Kinobegeisterung und dem Nachdenken über den »großen Tempel des bewegten Bildes« liegt die Frage zugrunde: Wie ist ein »Weiter Sehen« und eine Verständigung darüber möglich, wenn der Orteiner gemeinsamen Erfahrung zugunsten einer Privatisierung von Leben und Erleben demontiert ist?
In ihrem neuen Buch erzählt Esther Kinsky von der unwiderstehlichen Magie des Kinos, eines Ortes, »wo Witz, Entsetzen und Erleichterung ihren gemeinschaftlichen Ausdruck fanden, ohne dass die Anonymität im dunklen Raum angegriffen wurde«. Aller glühenden Kinobegeisterung und dem Nachdenken über den »großen Tempel des bewegten Bildes« liegt die Frage zugrunde: Wie ist ein »Weiter Sehen« und eine Verständigung darüber möglich, wenn der Orteiner gemeinsamen Erfahrung zugunsten einer Privatisierung von Leben und Erleben demontiert ist?