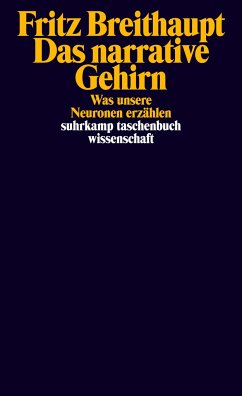Wer in Geschichten verstrickt ist, lebt intensiver - ich erzähle, also bin ich. Doch nicht nur das eigene Leben wird als Narration prägnanter. Mittels Erzählungen gelingt es uns auch, die Erfahrungen eines einzelnen Menschen zu solchen von vielen anderen zu machen. Dazu müssen unsere Gehirne und die Weisen, wie wir Geschichten erzählen, aufeinander abgestimmt sein. Doch wie genau geschieht das? Fritz Breithaupts brillantes Buch unternimmt eine Neubestimmung des Menschen als narratives Wesen. Narratives Denken, so zeigt er, wird stets mit spezifischen Emotionen belohnt, und das heißt: Wir leben, wie wir leben, weil wir diesen Belohnungsmustern folgen. In Narrationen kann darüber hinaus aber auch immer alles anders kommen, und ebendies erlaubt uns den Aufbruch zu neuen Ufern.
»Das narrative Gehirn bietet eine anregende Einführung in die Theorie des Erzählens.« Deutschlandfunk 20220718
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Burkhard Müller sieht den Germanisten Fritz Breithaupt mit seiner Narratologie auf dem Holzweg, und zwar gleich dreifach. Völlig verfehlt findet Müller Breithaupts Versuch, wissenschaftliche Exaktheit zu behaupten, indem er emotionale Wertigkeiten beim Weitererzählen von Geschichten misst, und dann auch noch ohne deren Inhalt zu beachten. Aber auch die Ausweitung des Begriffs "Narrativ" behagt dem Rezensenten nicht: Bilder sind keine Erzählung, und performative Sprechakte sind es auch nicht: Wenn ein Richter einen Angeklagten zu einer Haftstrafe verurteilt, ist dies eine Tat. Und schließlich kennt der Begriff des Narrativs kein Verhältnis zur Wirklichkeit, moniert Müller: Eine Lügengeschichte ist hier genauso Erzählung wie ein wahrheitsgetreuer Bericht. Für Müller wird hier Germanistik zur Märchenstunde.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Freundlich mögen die gehegten Gefühle sein: Fritz Breithaupt entwirft eine groß zugeschnittene Theorie des menschlichen Hangs zu Geschichten.
Welche Verbindungswege führen vom Bild einer Eule zum Bild einer Katze? Seit Längerem sind Forscher den Mechanismen kultureller Übertragung auf der Spur. Ein Pionier dieser Forschungsrichtung war der britische Psychologe Frederic Bartlett, der in seinem Buch "Remembering" (1932) den Zusammenhang zwischen Wahrnehmung, Vorwissen, Erinnerung und der Weitergabe von Informationen untersuchte. So ließ er etwa Probanden hintereinander eine Bildvorlage aus dem Gedächtnis nachzeichnen. In Fritz Breithaupts neuem Buch ist eine Illustration dieses Kettenexperiments abgedruckt. Dem ersten Probanden wurde die Umrisszeichnung eines Vogels vorgelegt, in dem Breithaupt mit ornithologischem Sachverstand eine Schleiereule erkennt. Der zweite Zeichner reichert die Zeichnung des ersten mit spitzen Ohren an. Einige weniger Talentierte lassen die weitergereichte Skizze von Mal zu Mal undeutlicher werden, bis endlich Nummer neun auf die Idee kommt, dem übrig gebliebenen Knäuel, aus dem gerade noch die Ohrenspitzen ragen, einen Schwanz anzufügen. Rettende Wendung, aus der Schleiereule ist eine Katze geworden. Ab da ist das Schema stabil, wie Breithaupt schreibt: "Katze ist Katze ist Katze."
Auf Sprache bezogen, ist diese Experimentalanordnung als Stille-Post-Spiel bekannt, in dem eine kleine Geschichte oder auch nur ein Wort durch mehrere Stationen von Mund zu Ohr geschickt wird. Breithaupt schöpft für sein Buch aus den Ergebnissen von Tausenden solcher Spiele, die er als Leiter des Experimental Humanities Laboratory an der Indiana University durchführen ließ. Sie bestätigen Bartletts Befund, dass Geschichten durch fortgesetzte Nacherzählung gleichsam rundgeschliffen, vereinfacht, von unverständlichen Elementen gereinigt und in vorhandene kulturelle Muster eingepasst werden. Anders als sein berühmter Vorgänger aber interessiert sich Breithaupt nicht nur für diese kognitive Dimension. Er entnimmt seinen Daten überdies Hinweise auf die zentrale Bedeutung von Emotionen für das Erzählen. Zumeist sind nämlich die Emotionen - heitere oder traurige, Peinlichkeit oder Rührung - das stabile Element in der Weitergabe einer Geschichte, während sich ihre inhaltliche Ausgestaltung verändert. Sie "werden zum Anker, an dem Geschichten festgemacht werden können".
Aus diesem Befund entwickelt der Autor eine großräumige Theorie der Evolutionsgeschichte des Erzählens. Ihm zufolge ist das Erzählen als eine uns Menschen auszeichnende Kommunikationsweise auf Belohnung aus, und diese Belohnung besteht in der Freisetzung von Emotionen. Dadurch würden wir angespornt, unsere narrativen Fähigkeiten zu entfalten - im Wachtraum, in der Alltagskommunikation und in der Vielzahl der fiktionalen Welten, in denen wir uns heimisch machen. Kraft seiner "Multiversionalität" weitet das Erzählen unseren Bewusstseinsraum. Es lädt uns ein, uns in unsere Mitmenschen zu versetzen; es befördert und schult das Vermögen der Empathie; es bündelt kollektive Aufmerksamkeit (joint attention). Vor allem aber lehrt es, sich in einer Welt pluraler Möglichkeiten zu bewegen, denn "im narrativen Denken sind wir immer in der Mitte einer Geschichte", erleben die ungewisse Lage der Protagonisten an uns selber mit und teilen ihr Sichtfeld, das zugleich eingeschränkt und offen ist. Weil Figuren in Erzählungen ihrer Natur nach "spielbar" (playable) sein müssen, löst das Erzählen dieser Argumentation zufolge starre Rollenmuster auf. "Noch das stärkste Stereotyp, das uns gefangen hält", befindet Breithaupt zuversichtlich, "wird im narrativen Denken aufgebrochen."
Es ist bemerkenswert, dass ein Autor, der erst vor wenigen Jahren mit einem Buch über die "dunklen Seiten der Empathie" hervorgetreten ist, in der nun vorgelegten Studie allein die gewissermaßen helle Seite des Geschichtenerzählens gelten lässt. Immer deutlicher tritt im Verlauf der Argumentation eine normative Einstellung zutage, die richtiges von falschem Erzählen unterschieden wissen will. "Falsches" Erzählen nimmt den Figuren die "Spielbarkeit" und bannt sie - und damit auch das miterlebende Publikum - in ein Korsett der Identität. "Richtiges" Erzählen dagegen befreit unseren Möglichkeitssinn. Am Ende mündet die Analyse in eine Ethik des Erzählens und seinen Lobpreis als schöpferische Aktivität, das uns, wie die Schlusswendung des Buches lautet, "ein intensiveres, reicheres Leben" verspricht.
Dass zu den Emotionen, zu denen Geschichten Erzähler und Zuhörer gleichermaßen animieren, auch Hass, Lust an Herabwürdigung und Mobilisierung von sozial konzertierter Gewalt zählen können, gerät so auf eine Nebenspur von Breithaupts groß angelegtem theoretischem Entwurf. Das hängt auch damit zusammen, dass nur freundliche Emotionen einen Anreiz für Geschichten bilden, will man sie als Belohnung verstehen. Aber Gefühle stellen sich ja nicht erst am Ende eines Erzählvorgangs ein. Wenn eine "eigentlich peinigende Episode", wie Breithaupt schreibt, sich durch ihre Wiedergabe im Freundeskreis in Gelächter auflöst oder wenn eine traumatische Erfahrung zu narrativer Bewältigung drängt, dann wirkt der Affekt schon am Anfang, nicht erst in der erleichternden Auflösung der Sequenz. Hier wäre es vermutlich sinnvoll, das vorgelegte Modell um die Kategorie des Durcharbeitens von affektiven Regungen nach Art der Psychoanalyse zu ergänzen.
Eine andere Rückfrage betrifft das "narrative Gehirn". "Bewusstsein", heißt es, sei wegen seiner notorischen Ungreifbarkeit ein "schwieriges" und für Akademiker womöglich karrieregefährdendes Wort, und von der "Seele" spricht ohnehin niemand mehr. Also "Gehirn". Aber obwohl Breithaupts Studie diesen Begriff im Titel trägt und obwohl er mit einer doppelten Professur in Germanistik und cognitive science einen Brückenschlag zwischen Geistes- und Naturwissenschaft verkörpert, kommen tatsächlich neurowissenschaftliche Befunde in dem Buch kaum zur Sprache. Im Kapitel über die "Evolution des narrativen Gehirns" ist hauptsächlich von der "Bühne" die Rede, diese wiederum in einem eher metaphorisch Sinn verstanden als kollektiver Aufführungsort von Geschichten. So wird auf dem jetzigen Stand des weit ausgreifenden erzähltheoretischen Projekts trotz vieler Ansätze noch nicht klar, wie sich evolutionsbiologische, neurophysiologische und kulturelle Entwicklungen ineinander verschränken.
Ein hervorstechendes Merkmal des Buches besteht in seiner eigenen erzählerischen Anlage. Es verknüpft die Entfaltung der begrifflichen Matrix nicht nur mit Alltagsbeispielen, die vorwiegend aus der Berufs- und Lebenswelt seines Verfassers geschöpft sind, sondern auch mit persönlichen Anekdoten. So wird die Darstellung fassbarer und spricht, das ist zu hoffen, ein breiteres Publikum an. Wie nebenher zieht Breithaupt sogar einen kriminologischen Erzählfaden ein. Schritt für Schritt lüftet er ein von seiner Mutter gehütetes Familiengeheimnis: dass der unter mysteriösen Umständen verstorbene Vater, ein Diplomat in den Zeiten des Kalten Krieges, einem politischen Mord durch den KGB zum Opfer fiel. Er lässt seine Leserschaft an der Überlegung teilhaben, wie seine Jugendjahre verlaufen wären, hätte er diesen Umstand nicht erst bei der Sichtung von Dokumenten nach dem Tod der Mutter erfahren. So wird miterlebbar, wie existenziell das Erzählen (oder das Verschweigen) von Geschichten sein kann. ALBRECHT KOSCHORKE
Fritz Breithaupt: "Das narrative Gehirn". Was unsere Neuronen erzählen.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2022. 368 S., Abb., geb., 28,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Das narrative Gehirn bietet eine anregende Einführung in die Theorie des Erzählens.« Deutschlandfunk 20220718