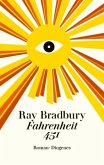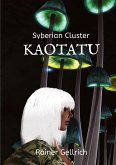In einem Hochhaus lebt ein Kind mit seinen Eltern - auf engstem Raum in der 5969. Etage. Wir wissen nicht, ob es ein Junge oder Mädchen ist, nicht, wie alt es ist, nicht, in welcher Zeit die Geschichte spielt, die das Kind in direktem, fast unbeteiligtem Ton erzählt. Es ist die Geschichte aller Menschen, die in dieser Zukunft leben. Nur dass dieses Kind neugieriger als alle anderen ist und ergründen will, was sich hinter dem oder eigentlich in diesem Beton verbirgt. Langsam dringen wir mit dem Kind in das GEBÄUDE ein, in seine Poren, seine Nervenbahnen, seine Adern.
Schemenhaft verstehen wir allmählich, wie sein Organismus lebt und welcher unerhörte Stoffwechsel ihn befeuert. Da gibt es ein Außen, wo Ausgestoßene leben, die alles geben, um wieder hineinzukommen. Wie sie sich dabei gegenseitig massakrieren, wird als disziplinierende Dauersendung auf einen großen Bildschirm in jede Wohnung übertragen. Wer sich dort nicht fügt, wird abgeholt und ausgestoßen. In wessen Auftrag? Man weiß es nicht, nicht einmal, ob es diese unsichtbare Macht überhaupt gibt.
Karoline Georges verbindet Science-Fiction, Naturwissenschaften und Existenzphilosophie zu einer verstörenden Dystopie, in der ein befremdliches Lebensgefühl spürbar wird und sich beim Lesen Maßstäbe verschieben. Das immer Ungeheuerlichere des zunehmend Entdeckten verliert sein Geheimnis nicht, es gewinnt eine eigene Wahrheit, und gerade dieses Paradox wirft uns zurück auf existenzielle Fragen. So konsequent hat uns noch kein Roman beunruhigt. Totalbeton kommt einer Erneuerung des Genres gleich.
Schemenhaft verstehen wir allmählich, wie sein Organismus lebt und welcher unerhörte Stoffwechsel ihn befeuert. Da gibt es ein Außen, wo Ausgestoßene leben, die alles geben, um wieder hineinzukommen. Wie sie sich dabei gegenseitig massakrieren, wird als disziplinierende Dauersendung auf einen großen Bildschirm in jede Wohnung übertragen. Wer sich dort nicht fügt, wird abgeholt und ausgestoßen. In wessen Auftrag? Man weiß es nicht, nicht einmal, ob es diese unsichtbare Macht überhaupt gibt.
Karoline Georges verbindet Science-Fiction, Naturwissenschaften und Existenzphilosophie zu einer verstörenden Dystopie, in der ein befremdliches Lebensgefühl spürbar wird und sich beim Lesen Maßstäbe verschieben. Das immer Ungeheuerlichere des zunehmend Entdeckten verliert sein Geheimnis nicht, es gewinnt eine eigene Wahrheit, und gerade dieses Paradox wirft uns zurück auf existenzielle Fragen. So konsequent hat uns noch kein Roman beunruhigt. Totalbeton kommt einer Erneuerung des Genres gleich.

Als habe sich George Orwell in ein Gemälde von Hieronymus Bosch verlaufen: Die Novelle "Totalbeton" der Frankokanadierin Karoline Georges.
Von Sandra Kegel
Dass es für die 1970 in Québec geborene multidisziplinäre Künstlerin Karoline Georges nichts Spekulativeres gibt als die Literatur, daran lässt ihr dystopisch-experimentelles Werk keinen Zweifel. Ihre Texte schaffen visuelle Denkräume, die sie mit einer alternativen Realität befüllt, vor der man zuweilen am liebsten davonlaufen möchte. Ein ums andere Mal kreiert sie schreibend verrätselte Bilder, die uns mit beklemmender Fremdheit konfrontieren, als hätte sich George Orwell in ein Gemälde von Hieronymus Bosch verlaufen. Karoline Georges' Figuren sind dabei einerseits greifbar und leben doch jenseits von Zeit und Raum in ihrer ganz eigenen Wirklichkeit, so auch das erzählende Kind in der Novelle "Totalbeton", dessen Name wir ebenso wenig erfahren wie sein Alter oder Geschlecht.
In Georges' Heimat Québec ist "Sous béton" bereits 2011 erschienen. Jetzt liegt die französische Erzählung in der geschmeidigen Übersetzung von Frank Heibert als erstes Buch dieser Autorin überhaupt auch auf Deutsch vor, und geschmeidig will in diesem Fall tatsächlich etwas heißen. Denn der Text erweist sich als so opak und hermetisch-verdichtet wie der tonangebende Baustoff, dem bekanntlich jeglicher Lufteinschluss ausgetrieben ist.
"Ich war in der 804 eingeschlossen, 5969. Etage." So fängt das an. Und damit endet der erste Absatz auch schon wieder. Das Gebäude, in dem das Erzählerkind mit seinen Eltern auf allerengstem Raum haust, eine gigantische Wohnmaschine, die zugleich die ganze Zivilisation in sich birgt, hat freilich noch sehr viel mehr Etagen. Während draußen, vor dem Horrorturm, nur getrennt durch eine Schicht Beton, sich derweil die Ausgestoßenen stapeln. Die Zuteilungen aus Antikörpern werden ihnen verwehrt, während die Bewohner mit "medizinischen Identnummern" und im Nabel implantierten Sonden ausgestattet sind, die täglich die biologische Qualität des Körpers durchfunken.
Postapokalyptisch ist diese Welt drinnen wie draußen. Die Turmbewohner leben in identischen Kabinen, werden beobachtet und überwacht, mit Nährstoffen gefüttert und Betäubungsmitteln ruhiggestellt. Die Bedingungen zu akzeptieren und alle Gedanken oder Fragen zu unterdrücken, das haben sie schon vor langer Zeit gelernt. Das Kind in der Wabe aber ist nun nicht etwa Teil einer verschworenen Schicksalsgemeinschaft, die der fremden Macht trotzt. Es ist vielmehr Opfer auch noch in dieser Binnensituation. Denn seine Eltern sind mörderische Gesellen, die ohne Unterlass Brüder und Schwester des Kindes ertränken, erwürgen oder ersticken, und auch auf das Kind haben sie es abgesehen. Es ist der nicht enden wollende Missbrauch eines brutalen Vaters und einer ängstlichen Mutter, der hier geschildert wird, der dabei in einem irritierenden Widerspruch zum klinisch-sterilen Ton der kindlichen Erzählerinstanz steht. Bewertet werden die Übergriffe so wenig wie alles andere, sondern vielmehr als Teil des Daseins klaglos akzeptiert: "Zweiundzwanzig Tage vor meinem Verschwinden wurde sie lebendig in Folie gepackt und mit spitzen Fingern von den Gesundheitspolizisten zur Entsorgungsanlage am Ende des Korridors getragen."
Weitere Gegensätze lassen sich ausmachen, der Beton natürlich, dieses scheinbar unzerstörbare Material, aus dem die klaustrophobische Welt gebaut ist, steht in scharfem Kontrast zur geistigen Beweglichkeit des Kindes. Denn es kann, immerhin, eigenständig denken - "Das Kind, das um sein Kindsein weiß, stellt sich ein mögliches Nach-der-Kindheit vor" - und wie niemand sonst hier erzählen und also die Stimme erheben. Zuletzt wird es eben diese gedankliche Beweglichkeit sein, die ihm den Ausbruch aus seiner albtraumhaften Existenz ermöglicht.
Der Moment, in dem es den Turm in seinen Grundfesten erschüttert, ist gekommen, als das Kind fragt: "Weshalb all das?" Indem es fragt, stellt es nicht nur die Eltern, den Turm und das ganze Dasein in Frage, sondern es gelingt ihm, gleichsam durch den Turm zu einer jenseitigen Welt vorzustoßen, die aus anderem Stoff gemacht ist. Da stellt sich dann auch heraus, dass die Welt da draußen gar nicht so ist, wie es immer hieß: ein tödliches Chaos aus Gewalt und Anarchie. Kommt so nach all dem Grauen am Ende noch ein happy ending über uns? Wohl kaum.
Karoline Georges, die seit ihrem literarischen Debüt 2001 zahlreiche Romane, Kurzgeschichten und Kinderbücher in Kanada veröffentlicht hat, bleibt hier konsequent pessimistisch und entwirft das Dasein als eine nicht enden wollende Erzählung von Gefangenschaft und Leid. In Heiberts fließender Übersetzung ihres durch Absätze und herausgestellte Wörter permanent unterbrochenen Texts bohrt sich die Sprache immer tiefer hinein in diese Hölle aus Zement.
Die frankokanadische Literatur, die lange Zeit unter dem Kitschverdacht überwiegend harmlos-lieblicher Cirque-du-Soleil-Romane stand, hat sich längst von diesem Vorurteil emanzipiert. Und auch Karoline Georges geht in ihrer düsteren Erzählung Wagnisse ein, und es gelingt ihr nicht zuletzt, trotz einer Vielzahl an unerhörten Begebenheiten gattungsgemäß sogar mit einer letzten irren Wendung aufzuwarten. Doch irgendwann unterwegs ist die kanadisch angerührte Dystopie in sich zusammengefallen wie ein Soufflé. Es war eben kein literarisches Neuland, das hier betreten wurde, sondern ein aus Versatzstücken gebautes Szenario, das uns aus der Science-Fiction-Literatur ebenso sattsam bekannt ist wie aus den Horrorvisionen des Kinos.
Mit dem nicht minder experimentierfreudigen Werk ihrer frankokanadischen Landsmännin, der hochbetagten Marie-Claire Blais, die mit der Übersetzung ihres Romans "Drei Tage, drei Nächte" gerade ebenfalls zum ersten Mal in Deutschland zu entdecken ist, kann Karoline Georges nicht mithalten. Während Blais' Textmonolith aus endlosen Sätzen, die sich über Seiten hinziehen und zu keinem Haltepunkt kommen, sich in einer quecksilbrigen Sprache bricht, ständig die Form wechselt und sich dabei ein verblüffend kühner Gedanke an den nächsten klammert, verliert Georges sich irgendwann im Schleier ihrer eigenen Schemenhaftigkeit. Ihre Bilder vom Innen und Außen oder vom Turm als lebendigem Organismus haben nichts Bezwingendes, vielmehr werden sie in ihrer aufgesetzten Rätselhaftigkeit zuletzt selbst so etwas wie die Gefangenen der Erzählung.
Karoline Georges: "Totalbeton". Roman.
Aus dem Französischen (Québec) von Frank Heibert. Secession Verlag, Zürich 2020. 140 S., geb., 22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensentin Christiane Lutz begibt sich in die Finsternis der Dystopie von Karoline Georges' Roman über ein Gebäude und seine Bewohner in einer Zeit der Sinnenlosigkeit und des willenlosen Funktionierenmüssens. Klingt vertraut? Dem Text haftet laut Lutz immer noch genügend philosophische Spekulation an, sodass man ihn nicht als Abbild unserer Lebenswelt lesen muss. Als Kapitalismus-Kritik taugt das Buch nur teilweise, meint sie. Dass die Autorin das Bauwerk im Buch, das seine Bewohner quasi gefangen hält, als evolutionären Fortschritt darstellt, weil es Schutz bietet, scheint Lutz bemerkenswert. Die Kraft des Textes aber liegt für sie in der Beschreibung eines Ausbruchsversuchs aus dem Unmenschlichen sowie in Georges' knapper, bisweilen poetischer rhythmischer Sprache.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH