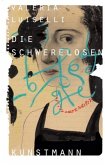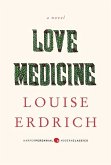Ein Fluch, der über einem Ort in der Pampa zu liegen scheint. Eine Heilerin, die vom Tode bedrohte Kinder zu retten versucht. Und zwei exzessiv liebende Mütter, deren Schicksale auf mysteriöse Weise verbunden sind. - Das Gift ist wie ein Alptraum, der sich schleichend entfaltet. Eine hypnotisierende Geschichte. Packende, fantastische Literatur.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Rezensent Kersten Knipp sieht Faszination und Langeweile nah beieinander im Debütroman von Samanta Schweblin. Wer schon die Erzählungen der Autorin mit ihrem Sinn fürs Unheimliche gemocht hat, meint Knipp, wird auch den Roman mögen. Wem allerdings das oft Surreale von Schweblins Kunst nicht behagt, der dürfte auch mit dieser Geschichte um eine in der argentinischen Pampa sich abspielende Entfremdung zwischen Mutter und Kind laut Knipp seine Schwierigkeiten haben. Kurze Sätze, Fragen ohne weiterführende Antworten, eine hermetische Welt und ein sich ausbreitendes Verlorenheitsgefühl, damit sieht sich Knipp konfrontiert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Als hätte David Lynch einen Roman geschrieben: Das Debüt der Argentinierin Samanta Schweblin steckt voller phantastischer Rätsel
Eine Feriensiedlung weit weg von der Stadt, ist der Schauplatz, zwei Kinder und ihre Mütter, die Erzählerin Amanda und Carla, die schöne Nachbarin mit dem goldenen Bikini, befinden sich dort. Die Frauen haben Angst um ihre Kinder, und sie haben allen Grund dazu. Denn ein unbekanntes Gift, das schon Pferde, Enten und Hunde getötet hat, greift offenbar auch auf Menschen über. Amanda berechnet panisch den "Rettungsabstand" zu Nina, das Maß für die Entfernung, die eine gute Mutter nie überschreiten sollte. "Der Faden ist so gespannt, dass ich ihn im Magen spüre", sagt sie einmal. Das überdehnte Band reißt; der Faden der Liebe wird sie erdrosseln. Oder hat Amanda etwas durcheinandergebracht?
So geheimnisvoll wie der Rettungsabstand ist auch das Gift, das in homöopathischen Dosen aus Samanta Schweblins Roman tropft. Manches deutet auf ein agrochemisches Pflanzenschutzmittel hin; einmal laden Männer Fässer von einem Lastwagen ab. Aber das Gift kann auch biologischer, magischer oder politischer Natur sein. Ziemlich sicher ist nur, dass Carlas Sohn David beim Beerdigen der toten Tiere auf Sotomayors Ranch mit dem Umweltgift in Berührung kam und krank wurde. Als er im Fieber von Würmern im Kopf phantasierte, brachte Carla ihn zu einer Heilerin. Die Schamanin konnte ihn nicht mehr retten, nicht im landläufigen Sinne jedenfalls, aber sie verhalf seiner Seele durch eine rituelle "Transmigration" zu einem neuen Körper. David lebt, aber ist es noch David? Carla fürchtet sich vor dem wimpernlosen, rotäugigen Kind, das sie mit leerem Blick anstarrt und nicht einmal mehr Mama zu ihr sagt. Der Rettungsabstand existiert nicht mehr: Aus der Mutter-Kind-Dyade ist ein fremdes Wesen geschlüpft, nicht gerade ein Monster, aber ziemlich "merkwürdig".
Jetzt sitzen Amanda und David im Dunkeln eines Hauses und versuchen zu rekonstruieren, was geschah. Die Kommunikation verläuft eher asymmetrisch. Amanda will von dem Jungen wissen, was sie und Nina bereits erlebt und noch zu erwarten haben. Aber immer wenn sie ihre Version der Geschichte erzählt, blockt er ab: "Das ist nicht wichtig", "Dafür haben wir jetzt keine Zeit". Amanda erzählt David, was sie nicht versteht; sie will ihm buchstäblich die Würmer aus der Nase ziehen. Doch er drängt zur Eile, denn er weiß, was Amanda nur ahnt: Sie wird sterben.
Samanta Schweblins Roman "Das Gift" lässt viele Fragen offen, und das liegt an der raffinierten Erzähltechnik der argentinischen Autorin. Wer spricht hier eigentlich, wo, wann und zu wem? Das Debüt der Siebenunddreißigjährigen ist dabei nicht viel länger als eine ihrer gefeierten Erzählungen, aber er ist nicht leicht zu lesen. Die Grenzen zwischen Ich und Du, Gestern und Heute verschwimmen; es gibt Dialoge im Dialog, Albträume im Traum, perspektivisch verzerrte Wahrnehmungen. Innen und Außen, erzählte Zeit und Erzählzeit, Vernunft und Wahn sind so verwirrend ineinander verschachtelt wie ein Möbiusband oder Eschers in sich zurücklaufende Treppen.
Was hier in der Außenwelt passiert, ist kaum der Rede wert, ab und zu gibt es eine kurze Autofahrt und am Ende einen vergeblichen Fluchtversuch. Vielleicht ist der Dialog im Dunkeln überhaupt nur das Selbstgespräch einer kranken Frau. Die Mütter, die sich wie eifersüchtige Rivalinnen vergleichen und belauern, sind jedenfalls "Teil dieses Wahnsinns", und die Väter sind ohnehin abwesend, wenn man sie braucht.
Amanda und der monströse Junge erschaffen im vorwärtsdrängenden Stakkato von Rede und Gegenrede, Frage und Antwort eine Realität, die so flirrend, leuchtend und verstörend ist wie ein Film von David Lynch. Die Filmwissenschaftlerin Schweblin gehört allerdings nicht zu den raunenden, tricksenden Autorinnen, die Wunder gern mit Mystifikationen verwechseln. In bester argentinischer Tradition, in den Fußstapfen großer phantastischer Erzähler wie Borges und Cortázar beschwört sie das Unmögliche, Irrationale und Bedrohliche in einer lakonischen, nüchternen, von der Sonne gleichsam ausgebrannten Sprache. Kein Wort ist zu viel, und wenn man nicht weiß, was es bedeutet: umso besser. Einmal ins Ohr geträufelt, entfaltet "Das Gift" einen unheimlichen Sog.
MARTIN HALTER
Samanta Schweblin: "Das Gift". Roman.
Aus dem Spanischen von Marianne Gareis. Suhrkamp Verlag Berlin 2015. 127 S., geb., 16,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Als hätte David Lynch einen Roman geschrieben: Das Debüt der Argentinierin Samanta Schweblin steckt voller phantastischer Rätsel.« Martin Halter Frankfurter Allgemeine Zeitung 20151205