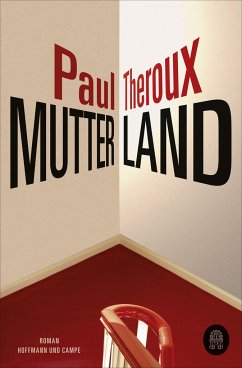«Mutterland zu lesen ist, als sähe man einem Autounfall in Zeitlupe zu. Es ist eine bösartige Abrechnung. Und es macht Spaß.» Stephen King
Alle in Cape Cod halten Mutter für eine wunderbare Frau: fleißig, fromm, genügsam. Alle außer ihrem Ehemann und ihre sieben Kinder. Für sie ist sie eine engstirnige und selbstsüchtige Tyrannin. Der Erzähler Jay, Reiseschriftsteller mittleren Alters, ist eines der sieben Kinder. Zusammen mit den Geschwistern findet er sich bei der Mutter ein, als der Vater stirbt - die erstickende Enge dort, im wortwörtlichen Mutterland, evoziert eine Bandbreite an Gefühlen, die dem Leser auf unheimliche Weise genau das präsentieren, was sonst immer nur der Horror der anderen ist.
Alle in Cape Cod halten Mutter für eine wunderbare Frau: fleißig, fromm, genügsam. Alle außer ihrem Ehemann und ihre sieben Kinder. Für sie ist sie eine engstirnige und selbstsüchtige Tyrannin. Der Erzähler Jay, Reiseschriftsteller mittleren Alters, ist eines der sieben Kinder. Zusammen mit den Geschwistern findet er sich bei der Mutter ein, als der Vater stirbt - die erstickende Enge dort, im wortwörtlichen Mutterland, evoziert eine Bandbreite an Gefühlen, die dem Leser auf unheimliche Weise genau das präsentieren, was sonst immer nur der Horror der anderen ist.
»unvergleichliche Wucht und ein befreiender Humor« Nils Minkmar Der Spiegel 20180401

Ein isolierter Volksstamm im Krieg mit sich selbst: In seinem autobiographischen Roman "Mutterland" porträtiert Paul Theroux die Familie als einen emotionalen Zwangsapparat.
Es ist, um mit Thomas Manns "Buddenbrooks" zu sprechen, der Tiefpunkt eines "unsäglich peinlichen Irrgangs": Ein gestandener Mann um die sechzig bricht in das Haus seiner greisen Mutter ein, um in ihren Aufzeichnungen herumzuschnüffeln. Und tatsächlich bewahrheitet sich sein schlimmer Verdacht: Über Jahre hinweg hat die Mutter ihre insgesamt sieben Kinder mit hohen Geldgeschenken bedacht - alle, nur nicht ihn selbst. Was sich dem Sohn beim Überfliegen der finanziellen Dokumente darbietet, ist eine Konfiguration der Familie in Zahlen: ein "Heptagramm" der Liebe, der Gleichgültigkeit, der Abneigung. Aber wen sollte er deswegen anklagen? Dem Sohn bleibt nur, seine Stellung ganz am Ende der Geld- und Gefühlsliste verbittert zu akzeptieren: "Jay Geburtstag $10".
Die Ironie dieser Szene besteht in der Tatsache des Einbruchs selbst, denn Jay, der als angesehener und bekannter Reiseschriftsteller weit herumgekommen ist, hat sein "Mutterland" eigentlich nie verlassen. Wie seine Geschwister ist er ein altes Kind, das sich nur räumlich aus dem Bannkreis der Mutter herausgelöst hat. Auf ihre Anerkennung ist all sein Handeln ausgerichtet, und dies schließt auch das brutale Wegbeißen der Konkurrenten, der Schwestern und Brüder, mit ein. Familie, das ist in diesem Roman ein emotionaler Zwangsapparat, in dem die Untertanen schmeichelnd um die Zuneigung einer "wahnsinnigen alten Königin" buhlen, während sie untereinander intrigieren, sich verleumden und bekämpfen. Es ist ein grausames Spiel, in dessen Mittelpunkt eine kaltherzige "Narzisstin" steht, die nichts tiefer befriedigt als die Unterwerfung ihrer eigenen Kinder.
Dass Jay als Reiseschriftsteller tätig ist und immer wieder fluchtartig das Weite sucht, sagt nicht nur etwas aus über seine "Angst, von meiner Familie erdrückt zu werden". Vielmehr erschließt sich aus diesem Figurenmerkmal die poetische Anlage des Romans: Genau wie seine Hauptfigur ist Paul Theroux seit Jahrzehnten auf Reisen und hat sich mit Büchern wie "The Old Patagonian Express" (1979) weltweit Ruhm erschrieben. Aber die autobiographischen Bezüge gehen hierüber noch hinaus, sowohl was Jays und Pauls großfamiliäre Herkunft aus Massachusetts als auch - und vor allem - das Alter ihrer Mütter betrifft, die beide älter als hundert Jahre geworden sind. Theroux hat umgesetzt, was er Jay in seinem Roman erwägen lässt: ein autobiographisches Werk, das die eigene Familie in den Mittelpunkt stellt, ohne dabei auf die Freiheit zu verzichten, "auszuschmücken, zu übertreiben, die wahren Verhältnisse gehörig auf den Kopf zu stellen". Nein, unbekannt ist dieses Verfahren der Fiktionalisierung in der Literaturgeschichte beileibe nicht, und auch der psychologische Realismus dieses Romans, den Theroux mit altmeisterlicher Souveränität beherrscht, wirkt eher konventionell.
Aber in einer avancierten Erzähltechnik besteht nicht der Anspruch dieses Romans. Vielmehr geht es Theroux um die Beantwortung einer psychologisch interessanten Frage, die nirgendwo in "Mutterland" ausgesprochen wird, obwohl sie jede Zeile des Buches durchdringt: Warum kann Jay von seiner tyrannischen Mutter, von dieser hasserfüllten Familie nicht lassen? Sämtliche Versuche der äußeren und inneren Distanzierung gehen nämlich fehl, und das obwohl ihm die Exilzeit, die er als Achtzehnjähriger mit seiner (schwangeren) Freundin auf San Juan verlebt hat, im Rückblick als "das beste Jahr seines Lebens" erscheint. Selbst positive Distanzerfahrungen wie diese können nichts daran ändern: Immer wieder kehrt Jay, der zum Teil über Jahre hinweg im Ausland lebt, zur Mutter zurück, und jeder Versuch, sich dieser unheimlichen Anziehungskraft zu entziehen, scheitert kläglich. Jay ist unfähig, sein Leben autonom zu gestalten: seine zwei Ehen sind fehlgeschlagen, die beiden Söhne fühlen sich ihm nur pflichtschuldig verbunden, eine längerfristige Beziehung ist er nicht zu führen imstande.
Entsprechend lässt der Roman kaum eine Figurenentwicklung erkennen; allenfalls der Schluss, mit dem Tod der Mutter und dem wohl endgültigen Auseinandergehen der Geschwister, deutet Hoffnung an. Bis dahin aber ist das Buch mit seinen fast 700 Seiten strukturiert durch immer neue Episoden der Annäherung und Abweisung, der Beleidigung und Verbitterung. Es ist eine grauenvolle, enervierende Dynamik, die für Außenstehende (und damit für die Leser) ebenso verschroben wie auf böse Weise komisch wirkt: So wird etwa für Angela, die unmittelbar nach der Geburt verstorbene Tochter, selbstverständlich bei allen Familienfeiern ein Platz direkt neben der Mutter freigehalten. Für Jay und seine Geschwister ist dies eine fortwährende Demütigung, denn der Heiligenstatus, den die Verstorbene für die Mutter einnimmt, ist für Irdische unerreichbar: "Ich habe heute früh mit Angela geredet. Es hat mir so viel Kraft gegeben. ,Sei stark, Ma', hat sie gesagt. Ihr wisst ja, wie sie ist." So gefühlig diese Bemerkung daherkommt - für die Geschwister ist sie ein Schlag ins Gesicht.
An gleich mehreren Stellen bezeichnet Jay seine Familie als "komplexen und durchgeknallten Clan". Entsprechend ethnologisch fällt seine Beschreibung - und die darin angelegte Begründung - des zwanghaften Familienzusammenhalts aus: Seine Familie erscheint ihm als "ein wütender, isolierter Volksstamm im Krieg mit sich selbst, regiert von einer unerklärlichen Wesenheit . . . der launischen Königin im ,Mutterland'". Wichtig ist hierbei der Aspekt der Isolation: Jay kann seine Familie nicht verlassen, weil es für ihn wie für die anderen kein Außen gibt, in das man sich flüchten könnte. Die Welt dieser totalen Familie hat keinen Ausgang, und selbst die Flucht in den Wahnsinn (Jays Vater verwechselt kurzzeitig sein Ich mit der von ihm verkörperten Figur in einer Minstrel-Show) bedeutet keine Befreiung. Insofern ist es kein Zufall, dass die "New York Times" ausgerechnet Stephen King gebeten hat, Theroux' Roman zu rezensieren: Passagenweise erinnert "Mother Land" tatsächlich an den klaustrophobischen Horror von "Misery".
Um gleichsam anthropologische Familienstrukturen geht es dem Autor allerdings nicht, im Gegenteil: In der Gegenüberstellung mit anderen familiären Kulturen (Jay lebt zeitweise in einem mexikanischen Dorf und findet dort wahlverwandtschaftlichen Anschluss) betont Theroux den genuin westlichen Charakter der von ihm porträtierten Sippschaft. Die Pointe steht dabei zwischen den Zeilen: Nur wer satt, wohlversorgt und abgesichert ist, wer also die Familie im wirklich existentiellen Sinne gar nicht braucht, kann sich auf so energieintensive Kämpfe um Liebe und Anerkennung, wie sie in diesem Buch geschildert werden, überhaupt einlassen. So gesehen, ist "Mutterland" nicht zuletzt dies: ein Roman der Dekadenz.
KAI SINA
Paul Theroux:
"Mutterland". Roman.
Aus dem Amerikanischen von Theda Krohm-Linke. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2018. 656 S., geb., 28,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main