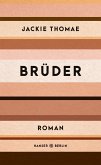Berlin, mitten in den Neunzigern. Die Stadt liegt da wie eine utopische Verheißung, offen für alle: für Fabian, den drogenaffinen Partyhengst, den dichtenden Alki Lennard, die depressiv-hysterische Lily, verkrachte Bildungsbürgerkinder und Hausbesetzer, die in verschiedenen Lebens-und Kunstdisziplinen vor sich hin dilettieren. Zwischen ihnen treibt Larissa durch die Stadt, geflüchtet aus der Provinz, möchte irgendwie studieren, ist aber zugleich auf der Suche nach vielfältigen Objekten ihres Begehrens: Sie träumt von dem Einen, Unerreichbaren, folgt Verlockungen am Wege, versucht sich in gesunder Zweisamkeit und verzehrt sich in einer schweren sexuellen Obsession - wie lange kann das alles gutgehen? Denn die Neunziger, das sind auch Abstürze und die Vorboten der Gentrifizierung. Irgendwann stellt sich auch für Larissa die ewige Frage, ob man ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft werden möchte - oder lieber als heiliger Outlaw im glamourösen subkulturellen Slackertum verschwindet.
Eine Hommage an das wilde, lebenshungrige Berlin und an die Zeit der wahren Party. Rebekka Kricheldorfs Roman ist ein sprachliches Feuerwerk, scharf gezeichnet und echt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Eine Hommage an das wilde, lebenshungrige Berlin und an die Zeit der wahren Party. Rebekka Kricheldorfs Roman ist ein sprachliches Feuerwerk, scharf gezeichnet und echt.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensentin Christine Dössel kann sich Rebekka Kricheldorfs Roman nicht ganz hingeben. Mit autobiografischen Anklängen, wie Dössel vermutet, erzählt die renommierte Theaterregisseurin von der 22-jährigen Larissa, die sich im Berlin der 90er-Jahre durchs Nachtleben schlägt. Das wird sehr "saftig" erzählt, mit skurrilen Figuren und fetzigen Dialogen, so die Rezensentin - Dössels Zeichnung des Berlinerischen "anarchokreativen" Slackertums überzeugt sie, auch wenn nicht alle Daten stimmen. Jedoch stört sie sich etwas an der politischen Trägheit der Protagonistin, und kritisiert vor allem, dass sich hinter all der sexuellen Zügellosigkeit letztlich doch nur eine Suche nach "Mr. Right" verberge. Am Ende leider nur eine schmuddeligere Version von Bridget Jones, schließt sie.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Brillant geschrieben ... Eine Hommage an die Freiheit der Jugend, die einmal auch die Freiheit Berlins nach der Wende war Claas Christophersen NDR Kultur "Buch" 20210325