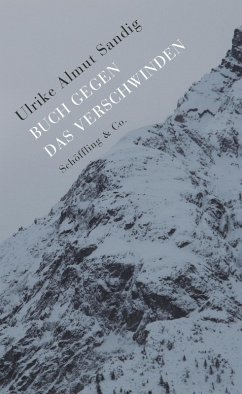Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH

Im Sturm verloren: Die Geschichten der Lyrikerin Ulrike Almut Sandig
Schriftsteller haben ihren eigenen Abwehrzauber gegen das Verschwinden von Menschen und Dingen: Sie erzählen darüber, und die Toten, die Verlorenen, die Vergessenen sind wieder da, jedenfalls für einen Moment in unserer Vorstellung. Die mit drei Lyrikbänden bekannt gewordene, 1979 geborene Ulrike Almut Sandig legt jetzt als zweite Prosaarbeit ein solches "Buch gegen das Verschwinden" vor.
Der Tod erhält in diesen Geschichten auf widersprüchliche Art eine Kontur. Es fängt damit an, dass eine gewisse Erika nicht einfach stirbt, sondern "verschwimmt", wie ihr Mann erzählt: "Sie wurde von den Rändern her durchsichtig", und man weiß wirklich nicht, ob das an seinen schlechter werdenden Augen liegt oder an Erikas Wenigerwerden.
Sandig zieht einen hinein in diesen Strudel des Vermissens. Und wenn sie dann als Ritual dieses Paares schildert, wie der Mann seiner Erika abends im Bett die Bodenschichten unter dem Haus beschrieb und dabei manchmal statt vom "Auelehm" vom "Geschiebelehm" oder vom "Geschiebemergel" sprach, erkennt man die wortbegeisterte Lyrikerin. Sie fängt sich aber schnell und lässt die Gedanken dieses Mannes weiter auf uns einwirken, bis wir ihn selbst fast verschwinden sehen.
Manchmal geht ein Ruck durch diese ansonsten eher ruhigen Geschichten. In der Eröffnungserzählung über den ersten gemeinsamen Ausflug eines Vaters mit seinem kleinen Sohn sowie der neuen Freundin des Vaters kommt es zu einer unschönen Szene: Die Freundin ohrfeigt den Partner, und dessen Sohn sieht es vom Strand. Da reißt uns die Erzählerin abrupt aus der Szene heraus und ruft: "Aber muss es so aufhören? Wenn wir schon im wirklichen Leben nichts wiedergutmachen können, warum dann nicht in den Geschichten, die wir uns später erzählen?"
Doch Erika, die Frau aus der Geschichte "Weit unter uns die flüssigen Felsen", bleibt trotzdem tot, und wir sehen, wie der Mann zum Friedhof geht und im Haus zunehmend vereinsamt, und die Erzählerin beschönigt nichts. Sie stößt mit ihren Sätzen höchstens mal das eine oder andere Hilfreiche an; ein Gespräch mit den Rot-Kreuz-Helfern oder dem Buchhändler, der dem täglichen Besucher "selbst gemachte" Bücher zusteckt, solche, die der Mann dann dreimal liest, obwohl er sie gar nicht versteht. Der Buchhändler verheißt dem Witwer auch, dass er sicher bald in der Gegenwart ankommen werde, weil er sich doch schon für die Erdzeitalter begeistere, und der Mann stimmt zu: "Auf seine Weise hatte er recht. Kam ich nicht langsam an der Oberfläche der Erde zum Vorschein?"
Sandigs Prosa gegen das Verschwinden erzählt in unterschiedlichen Tonfällen von Bindungen. Das ist kein Widerspruch, sondern vielmehr der Grund, warum das Verschwinden dann schmerzt. Ein Schweizer, eben noch Wanderbegleiter, geht im Sturm verloren. Ganze Dörfer samt Kirche verschwinden wegen der Braunkohle. Ein Mann verschwindet in seiner Krankheit, und die Familie wendet sich ab. Doch nirgendwo findet sich eine Spur Pathos oder Selbstmitleid. Sparsam setzt Sandig die Gegenstände des neuen Lebens ins Licht, die Krücken, den Rollator. So dezent, dass man sich selbst zusammenreimen muss, dass es bergab, nicht bergauf geht.
Als Chronisten schleichender Veränderungen schaffen diese Erzähler ein Textgewebe, das stark genug ist, das Flüchtige zu tragen. Untereinander pflegen die sechs Geschichten thematische Korrespondenzen, etwa, wenn eine Geschichte in Erwartung von Geburtstagsgästen endet und die Ich-Erzählerin der nächsten auf die Geburtstagsgeschichte des Bruders wartet - der vielleicht der Reporter aus der dritten Geschichte ist, aber mit anderem Schwerpunkt. Schön auch die kleinen, ungelösten Rätsel, die man zwischendurch vergisst, an die man aber am Ende wieder denkt. Wie an den Vorfall in einer kalten, dunklen, wolkenlosen Nacht. Irgendwas war da mit Erika passiert. Aber dem Mann fehlen die Worte: "Ein anderer als ich, in einer Sprache, die ich nicht kann, soll das beschreiben."
Sandigs scheinbar stolperlose, bildhafte, weiche Sprache kennt Sätze, die alles verdichten und verändern. Sie geht mit ganz eigenwilligen Kunstwaffen gegen das Verschwinden an. Oder nimmt sie es nicht vielmehr hin? Bei besonders schwierigen Fällen benutzt sie beharrlich die Anrede "du", wie in "Die blauen Augen deiner Mutter": Ein Journalist soll eine Reportage über die Demonstrationen im Gezi-Park schreiben und geht deshalb nicht ans Telefon: Es könnte seine Mutter sein, die sich dennoch in sein Leben schleicht, in Ausdrücken, die sie benutzt, und Erinnerungsbildern. Die Mütter und Väter verschwinden nie. Doch man könnte sie ins Gebet nehmen.
ANJA HIRSCH
Ulrike Almut Sandig: "Buch gegen das Verschwinden". Geschichten. Verlag Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2015. 205 S., geb., 18,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main